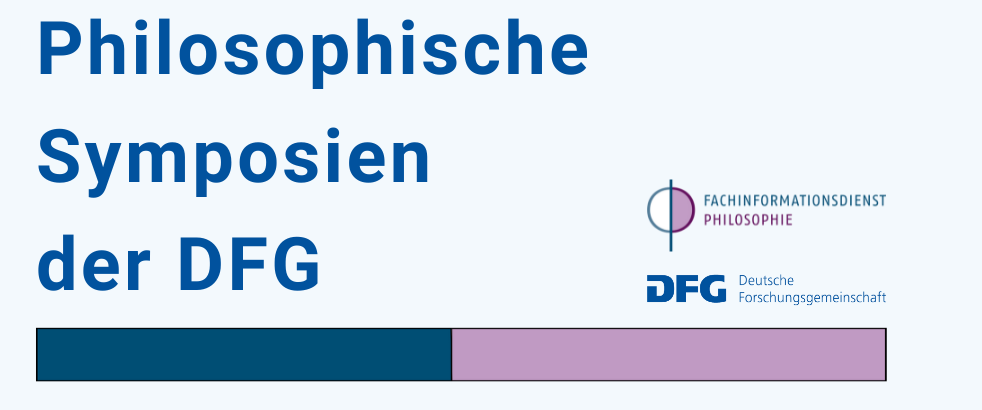Handeln aus Gründen und Dispositionen
Beitrag zum Philosophischen Symposium 2019 der Deutschen Foschungsgemeinschaft (DFG)
Handeln aus Gründen und Dispositionen
1Eine der wichtigsten Entwicklungen in der analytischen Philosophie des Geistes und Handlungstheorie der letzten 25 Jahre ist die ‚Wiederentdeckung‘ von Vermögen und Dispositionen, die dem entsprechenden ‚Revival‘ im Bereich der analytischen Metaphysik gefolgt ist. Vermehrt wird erkannt, dass sich zahlreiche mentale Phänomene nicht adäquat im Rahmen einer (im weiteren Sinne) ‚humeanischen‘ Metaphysik beschreiben und analysieren lassen, sondern dass mentale Einstellungen, absichtliches Handeln, (ethisch) tugendhaftes Handeln etc. am fruchtbarsten als Vermögen oder Manifestationen von Vermögen zu verstehen sind.
Ich halte die allgemeine Richtung dieser Entwicklung für völlig überzeugend und begrüßenswert. Aber die Erwartungen an den Rückgriff auf Dispositionen erscheinen mir in der Debatte jedenfalls teilweise unrealistisch hoch – und ich möchte in diesem Text anhand eines bekannten Problems eine ‚cautionary note‘ gegen solche m.E. überzogene Erwartungen vorbringen. Selbst in Bereichen, in denen es prima facie sehr naheliegend ist, dass der Wechsel von einem ‚humeanischen‘ zu einem dispositionalen Modell der entscheidende Schritt ist, um ein traditionelles Problem zu beheben, stimmt dies leider nicht immer. Das heißt nicht, dass dieser Wechsel nicht notwendig ist, aber er ist eben nicht mehr als ein erster Schritt.
Als Fallbeispiel für meine ‚cautionary note‘ wird das altbekannte Problem der sog. devianten Kausalketten dienen. Dieses Problem tritt für eine ganze Reihe von kausalen Analysen von mentalen Phänomenen auf, die typischerweise die folgende Struktur haben:2 Eine in besonderer Hinsicht als mental oder intentional qualifiziertes Phänomen (z.B. absichtliches Handeln, Wahrnehmung) wird analysiert über das Auftreten eines Elements, dem für sich genommen diese Qualifizierung fehlt – das also auch auftreten könnte, wenn das fragliche Phänomen nicht vorliegt – (z.B. Körperbewegung, Sinneseindruck), das jedoch im konkreten Fall eine besondere kausale Vorgeschichte hat (z.B. von Wünschen und Überzeugungen mit dem richtigen Inhalt bzw. einem äußeren Reiz des Nervensystems verursacht ist). Alle diese Theorien sehen sich bekanntlich mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass die im Analysans der kausalen Analyse vorgeschlagene ‚richtige‘ Ursache das angegebene ‚richtige‘ Ergebnis verursachen kann, ohne dass das zu analysierende Phänomen vorliegt, da die Verursachung ‚auf die falsche Weise‘ erfolgt ist. In den letzten Jahren hat man vermehrt zur Vermeidung dieses Problems auf dispositionale Versionen der kausalen Analysen zurückgegriffen: Die erforderlichen Ursachen müssen nicht nur Faktoren sein, die das Ergebnis in irgendeiner Weise (mit)herbeiführen, sondern sie müssen Dispositionen sein (oder mit Dispositionen verbunden sein), die sich in dem Ergebnis manifestieren und in diesem spezifischen Sinne als dessen Ursache zu verstehen sind.
Dieser Zug wurde in letzter Zeit vermehrt im Bezug auf die ‚aus einem Grund‘-Beziehung (oder ‚Stützungs‘-Beziehung) vorgeschlagen, die wir insbesondere bei Handeln aus Gründen oder Urteilen oder Glauben aus Gründen finden. Wenn ich glaube, dass die Straße nass ist, weil ich glaube, dass es geregnet hat, dann liefert die letztere Überzeugung (oder ihr Inhalt)3 den Grund dafür, aus dem ich glaube, dass es geregnet hat. Nach einer dispositionalen Analyse der ‚auseinem-Grund‘-Beziehung soll dies nicht (nur) erfordern, dass die letztere Überzeugung die erste (mit)verursacht hat, sondern auch, dass sich in dem Übergang zu meiner zweiten Überzeugung meine erste Überzeugung mit-manifestiert hat (oder dass sich in dem Übergang von der ersten zur zweiten Überzeugung andere einschlägige Vermögen von mir manifestiert haben).4 Dieser Rückgriff auf Dispositionsmanifestationen zur Rettung der kausalen Analysen vor dem Problem devianter Kausalketten ist äußerst naheliegend, da in der Debatte um kausale Analysen von Dispositionszuschreibungen das Problem devianter Kausalketten ebenfalls prominent aufgetreten ist: Auch bei Dispositionen müssen wir zwischen dem Fall, dass sich eine Disposition in einem bestimmten Ergebnis manifestiert, und dem Fall, dass sie beim Zustandekommen dieses Ergebnisses eine andere kausale Rolle spielt, unterscheiden. Sobald wir auf eine kausale Analyse von Dispositionen verzichten, können wir daher hoffen, auch das Problem devianter Kausalketten in der Philosophie des Geistes und Handlungstheorie zu vermeiden, wenn wir die einschlägigen kausalen Analysen in diesen Bereichen dispositional interpretieren. Aber diese Hoffnung ist, wie ich anhand des Falles von Handeln aus Gründen argumentieren werde, zumindest für manche einschlägige Phänomene leider verfrüht. Das alte Problem devianter Kausalketten in der Handlungstheorie bleibt in einer Form bestehen, denn dispositionale Interpretationen machen kausale Analysen zwar – wegen der Prozess-Spezifität von Dispositionsmanifestationen – gegen bestimmte Formen von kausaler Devianz immun, aber nicht gegen alle. Der Preis dafür, die verbleibenden Formen zu vermeiden, wäre, soweit ich sehen kann die Aufgabe des typischen Erklärungsziels der kausalen Analysen, zu deren Rettung die dispositionalen Analysen herangezogen werden sollen.
Im Folgenden werde ich zunächst das Problem abweichender Kausalketten in der Handlungstheorie kurz darstellen sowie zeigen, warum es naheliegend ist anzunehmen, dass dieses Problem mit dem Rückgriff auf Dispositionen verschwindet (1.). (Mit der Handlungstheorie vertraute LeserInnen können jedenfalls die erste Hälfte dieses Abschnitts leicht überspringen.) Im Anschluss möchte ich dann anhand eines Beispieltyps argumentieren, dass jedenfalls ein Teil des Problems abweichender Kausalketten bestehen bleibt (2.), einige mögliche Antworten seitens VertreterInnen einer dispositionalen Analyse auf diesen Beispieltyp diskutieren (3.) sowie einen Erklärungsversuch anbieten, warum das Devianzproblem sich als so hartnäckig erweist.
Zwei Bemerkungen vorab: Ich werde mich hier allein auf den Fall des kausalen Verständnisses von Handeln aus Gründen konzentrieren. Das strukturelle Problem, um das es mir geht, tritt jedoch (vermutlich) auch für eine Reihe anderer Phänomene auf, die die ‚aus einem Grund‘- Beziehung involvieren.5 Wie es sich im Einzelnen auf diese anderen Phänomene überträgt, ist es jedoch eine Frage, die ich hier aus Platzgründen dahinstehen lassen muss. Weiterhin werde ich im Folgenden die Ausdrücke ‚Vermögen‘ und ‚Dispositionen‘ austauschbar verwenden. Eine ‚Disposition‘ liegt zwar im strikten Sinne nur vor, wenn ihre Manifestation, falls die richtigen Ausübungsbedingungen vorliegen, auch auftreten muss, während dies nicht bei allen ‚Vermögen‘ der Fall ist. Aber dieser Unterschied soll uns hier nicht weiter interessieren und ich werde im Folgenden auch den Ausdruck ‚Disposition‘ so verwenden, dass das Auftreten des Stimulus die Manifestation nicht notwendig macht.
1. Handeln aus Gründen und deviante Kausalketten
Traditionell wird unter den Handlungen, die wir ausführen, die Gruppe der Handlungen, die wir absichtlich ausführen, als die zentrale angesehen. Für absichtliche Handlungen gibt es eine charakteristische Form der Erklärung, nämlich die Erklärung durch den Verweis auf diejenigen Gründe, im Lichte derer die Akteurin gehandelt hat und die sie zu ihren Handeln motiviert haben. Wir erklären z.B., warum Anna gerade den Fernseher angestellt hat, indem wir darauf hinweisen, dass sie den neuen Tatort sehen möchte, der gleich beginnt. Dass sie den Tatort sehen möchte, ist dann der (motivierende) Grund, aus dem Anna den Fernseher anstellt. Dieser Grund erklärt nicht nur, warum Anna ihre Handlung ausführte, sondern stellt auch eine Erwägung dar, im Lichte derer es für Anna sinnvoll war, jetzt den Fernseher anzustellen. Wir haben dabei in unserer alltäglichen Redeweise einen gewissen Spielraum, wie wir die motivierenden Gründe genau wiedergeben: ob wir Annas Wunsch nennen; ihre Überzeugung, dass der Film gleich beginnen würde; die Tatsache, dass er gleich los gehen würde; oder ihr Ziel beim Anstellen (‚Anna stellte den Fernseher an, um den Tatort zu sehen‘). (Diese Liste ist nicht erschöpfend.) Es ist umstritten, wie sich diese verschiedenen Formulierungen zueinander verhalten und ob eine davon die ‚wirkliche Natur‘ des motivierenden Grundes wiedergibt, aber das soll uns hier nicht interessieren. Der Einfachheit halber werde ich mich im Folgenden auf die letzte Version konzentrieren, also auf teleologische Erklärungen, die wir typischerweise durch die ‚um-zu‘-Redeweise oder durch die Angabe des Wunsches, den Anna durch ihre Handlung realisieren wollte, ausdrücken. Denn diese Erklärungen haben in der Debatte um die Rolle von Gründen den zentralen Platz eingenommen.
Die meisten PhilosophInnen der analytischen Tradition waren (und sind noch) der Auffassung, dass es sich bei teleologischen Erklärungen (und anderen Erklärungen durch motivierende Gründe) um eine Form von Kausalerklärung handelt, und dass der Grund, aus dem der Akteur gehandelt hat, eine kausale Rolle für das Zustandekommen der Handlung gespielt haben muss, damit eine solche Erklärung wahr ist. Die Einordnung als Kausalerklärungen wird dabei für die meisten PhilosophInnen dieser Tradition (immer noch) als nötig angesehen, um teleologische Erklärungen als echte Erklärungen zu auszuzeichnen und sie von bloß scheinbar erklärenden reinen ‚Rationalisierungen‘6 zu unterscheiden.7
Der locus classicus für diese Begründung einer kausalen Deutung teleologischer Erklärungen ist Donald Davidsons Actions, Reasons, and Causes. Davidson deutete hier sog. primäre Handlungsgründe als Kombinationen aus Wünschen und Überzeugungen der Akteurin, aufgrund derer aus Sicht der Akteurin etwas für ihre Handlung sprach und diese Handlung (in gewisser Weise) für sie ‚Sinn machte‘. (Z.B. weil die Handlung nach Überzeugung der Akteurin ein geeignetes Mittel darstellte, etwas zu realisieren, was die Akteurin erreichen wollte.) Dass wir eine passende Wunsch-Überzeugungs-Kombination der Akteurin, die aus ihrer Handlung ‚Sinn macht‘, identifizieren können, so Davidson, genügt jedoch noch nicht für eine echte Erklärung der Handlung. Denn eine Akteurin kann im Zeitpunkt ihrer Handlung verschiedene Gründe dafür haben, die Handlung auszuführen, aber dennoch nur aus einem dieser Gründe handeln. Wir brauchen daher zusätzlich zum Element der ‚Rationalisierung‘ ein weiteres Element, das denjenigen Grund (bzw. dasjenige Ziel), aus (bzw. mit) dem die Akteurin gehandelt hat, von den anderen Gründen unterscheidet, aus denen sie lediglich hätte handeln können. Und Davidson zufolge war der beste Kandidat für dieses zusätzliche Element eine Verursachungsrelation zwischen der Wunsch-Überzeugungs-Kombination, aus der die Akteurin tatsächlich gehandelt hat, und der Handlung.
„In order to turn the first ‚and‘ to ‚because‘ in ‚He exercised and he wanted to reduce [weight] and thought exercise would do it‘, we must, as the basic move, augment [the rationalization] condition with:
C2. A primary reason for an action is its cause.“8
Als Davidson die erstmalig veröffentlichte Version dieses Textes schrieb, ging er davon aus, dass das kausale Element zusammen mit dem Rationalisierungselement (und möglicherweise einem weiteren Zusatzelement) eine vollständige reduktive Analyse von Handeln aus Gründen oder mit einem Ziel ermöglichen würde. Diese Hoffnung hat er jedoch bald aufgegeben. Der entscheidende Grund dafür war bekanntlich Davidsons ‚Entdeckung‘ des Problems abweichender Kausalketten, also Fällen, in denen mentale Zustände mit dem richtigen Inhalt eine Körperbewegung verursacht haben, die sie rational verständlich machen, die resultierende Körperbewegung aber keine Handlung darstellt, die aus dem entsprechenden Grund ausgeführt wurde (bzw. keine Handlung mit dem Ziel, den entsprechenden Wunsch des Akteurs zu befriedigen).9 Um Davidsons eigenes bekanntestes Beispiel dieser Art zu nehmen:
„A climber might want to rid himself of the weight and danger of holding another man on a rope, and he might know that by loosening his hold on the rope he could rid himself of the weight and danger. This belief and want might so unnerve him as to cause him to loosen his hold, and yet it might be the case that he never chose to loosen his hold, nor did he do it intentionally.“10
Um eine vollständige kausale Analyse von Handeln aus Gründen und von absichtlichem Handeln zu liefern, so Davidson, müssten wir charakterisieren können, was eine ‚richtige‘ kausale Route ist, die von dem Wunsch und der Überzeugung zur Handlung führen muss (bzw. müssen), damit ein absichtliches Handeln aus Gründen vorliegt. Und Davidson (wie viele andere nach ihm) kam zu der Überzeugung, dass eine solche Charakterisierung nicht in einer informativen und nicht-zirkulären Weise möglich sei. (Nach seiner eigenen späteren Auffassung war die Suche nach einer rein kausalen Charakterisierung dieser Route aufgrund der irreduzibel normativen Erwägungen, die bei der Zuschreibung psychologischer Prädikate eine Rolle spielen, zum Scheitern verurteilt).11
Die Möglichkeit des Auftretens devianter Kausalketten untergräbt natürlich nicht die Annahme, dass diejenigen Wünsche und Überzeugungen, die den motivierenden Grund der Akteurin darstellen (oder ihm entsprechen), auch ursächlich für ihre Handlung sind. Deviante Kausalketten sind durchaus kompatibel mit der These, dass eine wahre teleologische Erklärung entsprechende kausale Verbindungen voraussetzt. Aber sie drohen die These zu untergraben, dass der Unterschied zwischen dem motivierenden Grund, aus dem der Akteur handelt, und anderen Gründen, die er im Zeitpunkt seiner Handlung hat, gerade ein kausaler Unterschied ist. Und die Hoffnung, den ersteren Unterschied erklären zu können, war es ja gerade, mit der Davidson die Annahme einer kausalen Verbindung zwischen motivierendem Grund und Handlung motiviert hat. Daher stellen deviante Kausalketten auch für diejenigen Vertreter einer kausalen Theorie von Handeln aus Gründen ein Problem, die nicht das Anliegen haben, eine reduktive Analyse zu liefern.
Ob sich das Problem devianter Kausalketten durch Einfügung von hinreichend komplexen Zusatzbedingungen für die ‚kausale Route‘ im Rahmen einer im weiteren oder engeren Sinne ‚Humeanischen‘ Konzeption von Kausalität lösen lässt, ist eine weiterhin offene Frage.12 Aber eine Reihe von PhilosophInnen hat in den letzten Jahren erkannt, dass der Rückgriff auf Dispositionen eine grundlegend neue Herangehensweise an das Problem und eine neue Verteidigung der kausalen Analyse ermöglicht.13 So hat z.B. John Hyman argumentiert, dass es uns ein Realismus bzgl. Dispositionen, der eine Analyse von Dispositionszuschreibungen als verdeckte Konditionalaussagen oder Aussagen über ‚humeanische‘ Kausalzusammenhänge verwirft, ermöglicht zu verstehen, dass das Problem devianter Kausalketten kein besonderes Problem für kausale Handlungstheorien ist. Vielmehr ergibt sich dieses Problem daraus, dass Wünsche und Überzeugungen Dispositionen sind und dass sich jeder Versuch, die Manifestation einer Disposition mit dem Auftreten einer durch ‚humeanische‘ Ereigniskausalität verbundene Kette von Geschehnissen zu identifizieren, mit demselben Problem konfrontiert sieht.
“The fact that there can be a ‘deviant’ causal connection between a desire and an act that is conducive to satisfying it has nothing particularly to do with reasons or desires. The reason is simply that desires are dispositions, and …. every disposition can be connected to the kind of occurrence that normally manifests it by a ‘deviant’ or ‘freakish’ causal chain …”14
Dass wir auch bei anderen Dispositionen zwischen den Fällen unterscheiden müssen, in denen ein Ergebnis die Manifestation der Disposition ist (oder ihrem Auftreten geschuldet ist), und denjenigen Fällen, in denen die Disposition in anderer Weise beim Zustandekommen des Ergebnisses eine kausale Rolle spielt, ist aus der Debatte um kausale Analysen von Dispositionszuschreibungen bekannt. Nehmen wir den Fall einer instabilen – also leicht einstürzenden – Brücke. Der Zusammenbruch dieser Brücke kann entweder der Manifestation ihrer Disposition, leicht einzustürzen, geschuldet sein (wenn die Brücke z.B. beim Überqueren eines leichten Fahrzeuges einstürzt). Er kann aber auch in anderer Weise kausal der Instabilität der Brücke geschuldet sein, wenn z.B. die zuständige Behörde durch die Instabilität der Brücke dazu motiviert wird, die Brücke sprengen zu lassen.15
Für viele PhilosophInnen sprechen derartige Fälle entscheidend gegen die Möglichkeit einer kausalen Analyse von Dispositionszuschreibungen, solange eine derartige Analyse ein ‚Humeanisches‘ Verständnis von Kausalität zugrunde legt.16 Denn bei einem solchen Verständnis ist in den beiden eben beschriebenen Fällen die Instabilität der Brücke in gleicher Weise Ursache ihres Einsturzes. (Ebenso wie in Davidsons Fall des Kletterers der Wunsch und die Überzeugung des Kletterers in gleicher Weise Ursache dafür waren, dass er das Seil los ließ, wie wenn er sich auf ihrer Grundlage entschieden hätte, dies zu tun.) Der Grund dafür ist, dass ‚Humeanische‘ Kausalität nicht ‚prozess-spezifisch‘ ist: Der kausale Zusammenhang zwischen A und B hängt nicht davon ab, auf welche Weise A B hervorgebracht hat. Jeder kausale Pfad (oder zumindest sehr viele) sind in dieser Hinsicht ‚gut genug‘.17 Dies stellt dann Anhänger der kausalen Analyse vor die mühselige Aufgabe, in einem zweiten Schritt durch Einführung weiterer Anforderungen an die kausale Verbindung die ‚richtige‘ kausale Route für das konkreten Phänomen zu spezifizieren. Dispositionsmanifestationen sind dagegen nach vorherrschender Auffassung prozess-spezifisch,18 d.h. ein ‚falscher‘ Zwischenschritt beim Zustandekommen des Ergebnisses kann die Aussage falsifizieren, dass dieses Ergebnis auf die Manifestation der Disposition zurückgeht.
Wenn wir diese Einsicht auf den Fall von Handeln aus Gründen übertragen, dann scheint ein dispositionales Verständnis von Wünschen und Überzeugungen eine sehr einfache und elegante Lösung für das Problem devianter Kausalketten zu liefern. Denn dann können wir zwischen denjenigen Fällen unterscheiden, in denen eine Handlung die Manifestation eines Wunsches bzw. einer Überzeugung ist, und den Fällen, in denen der Wunsch bzw. die Überzeugung nur auf andere Weise für das Zustandekommen einer Handlung, oder Körperbewegung ursächlich war. Und es ist naheliegend, den zweiten Falltyp (also kausale Rolle ohne Manifestation) gerade als den Falltyp ‚devianter Verursachung‘ zu identifizieren und zu verlangen, dass bei einer ‚richtigen‘ (im Sinne von: für ein Handeln aus Gründen erforderlichen) Verursachung die resultierende Handlung auch eine Manifestation des Wunsches bzw. der Überzeugung sein muss. Das ist genau der Vorschlag John Hymans, der glaubt, dass sich auf dieses Weise die kausale Analyse erfolgreich rehabilitieren lässt.19
“the causal chain can be described as ‘deviant’ […] because the disposition is not manifested. Exactly the same is true of desires. … [the climber’s] desire is a causal factor … but the process can be described as ‘deviant’ if letting go is an effect or ‘symptom’ but not a manifestation or ‘criterion’ of the desire”.20
(Der Unterschied zwischen ‘Symptom’ und ‘Kriterium’ soll dabei genau dem Unterschied zwischen Manifestation und anderer kausalen Wirkung entsprechen.)
Das Problem devianter Kausalketten in der Handlungstheorie wäre demnach tatsächlich nur eine Instanz des generellen Problems für kausale Analysen von Dispositionszuschreibungen und –manifestationen.21
2. Etwas enthusiastisch tun vs. etwas aus einem Grund tun
Der Erfolg dieser Charakterisierung von ‚Devianz‘ hängt freilich davon ab, dass der Unterschied zwischen ‚Symptom‘ und ‚Manifestation‘ (in der Terminologie des Zitats oben) zumindest extensional mit dem Unterschied zwischen den Fällen zusammenfällt, in denen eine Akteurin einen Grund für ihre Handlung hat, aus dem sie nicht handelt, obwohl er ihr Verhalten anderweitig kausal beeinflusst, und den Fällen, in denen sie tatsächlich aus diesem Grund handelt. Denn das ursprüngliche Problem kausaler Devianz besteht ja gerade darin, dass Wunsch und Überzeugung eine Handlung rationalisieren und verursachen zu können, ohne dass die Akteurin aus dem entsprechenden Grund (bzw. mit dem entsprechenden Ziel) handelt. Wenn das Scheitern des ursprünglichen Davidsonschen Ansatzes gerade daran liegen sollte, dass dieser auf ein Humeanisches Bild von Verursachung festgelegt war (wie es PhilosophInnen wie Hyman annehmen), müsste dieses Problem verschwinden, sobald wir das Humeanische durch das dispositionale Verständnis von Verursachung ersetzen und verlangen, dass sich Wunsch und Überzeugung auch in der Handlung manifestieren müssen. Wenigstens muss das dann gelten, wenn auch die Rationalisierungsbedingung erfüllt ist (da diese erste Bedingung der ursprünglichen Analyse plausiblerweise weiter erhalten bleibt).22
Um die Frage zu beantworten, ob die beiden Unterscheidungen – zwischen ‚Symptom‘ und ‚Manifestation‘+Rationalisierung einerseits, und Fällen, wo ein Grund das Handeln nur kausal beeinflusst, und Fällen, wo aus diesem Grund gehandelt wird – tatsächlich extensional zusammenfallen, müssen wir einen Blick darauf werfen, was die Manifestationen von Wünschen und Überzeugungen sind. Der Einfachheit halber werde ich mich dabei auf Wünsche konzentrieren, da deren Manifestationen für unsere spätere Argumentation die entscheidende Rolle spielen werden. Wünsche haben nach Hyman – und das erscheint plausibel – zwei wesentliche Manifestationen: “first, … purposive or goal-directed behaviour, specifically, behaviour aimed at satisfying the desire …; and, second, … feeling glad, pleased, or relieved if the desire is satisfied, and sorry, displeased, or disappointed if it is frustrated.”23 Die letzteren Gefühle “can in turn be manifested in non-purposive behaviour, as when a child claps her hands with delight or stamps her foot with annoyance”.24 Nach dem m.E. vielversprechendsten Verständnis sind solche Gefühle selbst als komplexe Dispositionen zu verstehen, einerseits zu bestimmten behaviourale Äußerungen, andererseits zu bestimmten bewusst empfundenen Gefühlszuständen. Eindeutig zu eng erscheint jedoch der Vorschlag Hymans, dass die behaviouralen Manifestationen selbst kein zielgerichtetes Verhalten sein sollten: Oft äußert sich z.B. ein Gefühl der Freude oder Zufriedenheit darin, dass wir Handlungen, die unsere Wünsche befriedigen und die selbst zielgerichtet sind, auf besonders enthusiastische Weise tun. (Wenn ich jemanden gerne treffe, dann gehe ich typischerweise mit schwungvollerem Schritt zu dem Treffen, als ich es tun würde, wenn ich mich auf das Treffen nicht besonders freue.) In diesem Fall äußert sich meine Zufriedenheit darin, wie ich eine zielgerichtete Handlung ausführe (wenn auch nicht in der teleologischen Struktur dieser Handlung, sondern nur ihrer emotionsbedingten ‘Färbung’).
Aus dieser letzteren Möglichkeit ergibt sich nun ein schwerwiegendes Problem für Hymans Analyse, da es Fälle gibt, in denen meine Handlung meinen Wunsch, X zu tun, in der zweiten Weise manifestiert, dieser Wunsch die Handlung auch rationalisiert (da ich weiß, dass die Handlung den Wunsch realisiert), ich aber dennoch die Handlung nicht deshalb ausführe, um den Wunsch X zu tun zu realisieren (und daher nicht aus dem entsprechenden Grund handle). Nehmen wir als Beispiel den folgenden Fall:25
Anna ist die Dirigentin im Stadtorchester, in dem ein freigewordener Cello-Platz neu besetzt werden muss. Gerade hört Anna zusammen mit dem administrativen Leiter des Orchesters den zwei vielversprechendsten Kandidatinnen, Josephine und Charlotte, beim Probevorspielen zu, und Anna wird direkt nach dem zweiten Vorspiel dem Leiter mitteilen, wer die Stelle bekommen soll. Die Entscheidung über die Neubesetzung liegt dabei de facto allein bei Anna: sie muss dem administrativen Leiter ihre Entscheidung zwar mitteilen, aber er wird ihr automatisch folgen. Wie es der Zufall so will, kennt Anna Josephine und Charlotte schon von früheren Gelegenheiten und Josephine ist ihr sehr viel sympathischer als Charlotte. Deshalb hat Anna einen sympathiebasierten Wunsch, dass Josephine und nicht Charlotte die Stelle bekommen soll. Aber gleichzeitig hat Anna eine sehr strikte Vorstellung von ihrer professionellen Rolle und von Fairness bei ihrer Ausübung: Sie ist davon überzeugt, dass bei ihrer Entscheidung über die Stellenvergabe persönliche Sympathie keine Rolle spielen darf und es nur darauf ankommen darf, welche der beiden Kandidatinnen beim Probevorspielen besser ist. Aber – zum Glück für Anna – beim Probevorspielen ist Josephine tatsächlich besser als Charlotte. Hocherfreut ruft Anna daraufhin dem administrativen Leiter zu: ‘Josephine soll die Stelle bekommen!’ Hätte sie nicht auch den sympathiebasierten Wunsch gehabt, dass Josephine die Stelle bekommt, und wäre daher über das Resultat nicht so erfreut gewesen, hätte sie dagegen ihre Entscheidung nicht in der Form kommuniziert. Sie hätte sie dann den Namen der betreffenden Kandidatin auf einen Zettel geschrieben und dem administrativen Leiter gereicht und diesem dann die weitere Kommunikation überlassen (Anna ist, so können wir uns vorstellen, normalerweise eine eher trockene Person).
Betrachten wir nun die Handlung Annas, die darin besteht, dass sie dem Leiter zuruft ‘Josephine soll die Stelle bekommen!’ Für diese Handlung war Annas sympathiebasierter Wunsch, Josephine möge die Stelle bekommen, nicht nur mitursächlich, sondern in dieser Handlung hat sich dieser Wunsch auch (mit)manifestiert. Denn Anna hätte diese Handlung nicht nur ohne diesen Wunsch nicht ausgeführt (sondern die substantiell verschiedene Handlung, dass sie Josephines Namen auf einen Zettel geschrieben und diesen weitergereicht hätte). In der Handlung hat sich auch Annas Zufriedenheit mit dem Ergebnis und damit auch ihr dieser zugrundeliegende Wunsch, Anna möge die Stelle bekommen, nach außen hin ausgedrückt.26 (Denn, wie wir gesehen haben, etwas auf freudige Weise zu tun, ist ein charakteristischer behaviouraler Ausdruck für das Gefühl der Zufriedenheit und ein Kriterium dafür, dass man mit seinem Tun zufrieden ist.) Zudem wurde Annas Handlung von ihrem Wunsch, Josephine möge die Stelle bekommen, auch rationalisiert: Wie Anna selbst klar war, stellte sie durch ihren Zuruf an den Leiter sicher, dass Josephine die Stelle bekam, und damit, dass ihr sympathiebasierter Wunsch verwirklicht wurde. Dieses Bewusstsein bei Anna war mitverantwortlich dafür, dass sie so zufrieden war und ihre Entscheidung in der für sie ungewohnten schwungvollen Weise kommunizierte.
Dennoch handelte Anna nicht deshalb, um ihren sympatiebasierten Wunsch zu verwirklichen. Denn sie glaubte, dass dieser Wunsch für ihre Entscheidung keine Rolle spielen dürfte, da dies mit ihrer eigenen Konzeption ihrer professionellen Rolle nicht übereinstimmen würde. Und wir können annehmen, dass sie im konkreten Fall dieser Rolle auch gerecht geworden ist und dem Leiter nicht deshalb zugerufen hat ‘Josephine soll die Stelle bekommen!’, um ihren sympathiebasierten Wunsch zu befriedigen, sondern nur weil Josephine tatsächlich beim Vorspielen besser war. (Wir können zusätzlich annehmen, dass Anna auch nicht die Absicht hatte, ihrer Freude Ausdruck zu verleihen: Dass sie ihre Entscheidung auf diese enthusiastische Weise kommunizierte, war einfach ein natürlicher Ausdruck ihrer Freude.)
In Annas Fall ist also sowohl die Manifestations-als auch die Rationalisierungsbedingung erfüllt, aber die Akteurin hat dennoch nicht gehandelt, um den entsprechenden Wunsch zu realisieren. Fälle dieser Art zeigen, dass wir die kausale Theorie von Handeln aus Gründen nicht einfach dadurch retten können, dass wir ein Humeanisches Verständnis von Kausalität durch ein dispositionales ersetzen, und dass Hymans vorgeschlagenes Verständnis von ‘deviant’ nicht erfolgreich ist. Denn obwohl sich Annas sympathiebasierter Wunsch in ihrer Handlung manifestierte, manifestierte er sich nicht ‘in der richtigen Weise’, damit ihre Handlung aus dem entsprechenden Grund ausgeführt worden wäre.
Fälle mit der beschriebenen Struktur sind m.E. auch keine seltenen Ausnahmefälle. Denn es ist ein charakteristisches Merkmal von Wünschen, dass wir das, was wir tun wollen, auch gerne tun, und dass sich letzteres in der ‘emotionalen Färbung’ der Handlung und der Art, wie wir sie ausführen, ausdrückt. Gleichzeitig passiert es aber recht häufig, dass wir Dinge tun, die wir tun wollen, ohne dass wir sie tun, um diesen Wunsch zu befriedigen. (Insbesondere wenn wir glauben, dass moralische Gründe oder ‘Rollenerwägungen’ – z.B. das Ideal des unparteilichen Richters – einem Handeln aus diesem Wunsch entgegenstehen).
3. Lässt sich die kausale-cum-dispositionale Analyse retten?
In diesem Abschnitt möchte ich auf einige mögliche Antworten eingehen, die eine Vertreterin der kausal-dispositionalen Analyse gegen die dargestellten Problemfälle geben könnte. Da bei der Argumentation des letzten Abschnitts primär an John Hymans Darstellung angeknüpft hatte, möchte ich zunächst zwei Antworten untersuchen, die auf der Basis seines eigenen Vorschlages gegeben werden könnten (3.1.-3.2.), bevor ich mich Antworten zuwende, die Vertreterinnen von etwas anders gestalteten kausal-dispositionalen Analysen anführen könnten (3.3. – 3.4.). Alle Ansätze sind jedoch m.E. entweder erfolglos oder nur dann erfolgreich, wenn sie das Erklärungsziel der kausalen Analyse in Nachfolge Davidsons, den Unterschied zwischen ‘einen Grund für seine Handlung haben’ und ‘aus diesem Grund handeln’ zu erklären, aufgeben.
3.1. Zunächst könnte man vermuten, dass das Beispiel der Dirigentin Anna nur deshalb als ein Gegenbeispiel gegen die These, dass die Fallgruppen ‘Rationalisierung und Manifestation eines Wunsches’ und ‘Handeln zur Verwirklichung dieses Wunsches’ zusammenfallen, erscheint, weil das Beispiel nicht präzise genug beschrieben ist. Damit der Fall ein echtes Gegenbeispiel gegen die These darstellt, müsste sich in genau derselben Handlung Annas, die von ihrem sympathiebasierten Wunsch rationalisiert wird, dieser Wunsch auch manifestieren. Diese Bedingung scheint zwar zunächst erfüllt bzgl. der Handlung Annas, die darin bestand, dass sie dem Leiter zurief ‘Josephine soll die Stelle bekommen’. Aber man könnte einwenden, dass wir Handlungen sehr viel ‘feinkörniger’ individuieren müssen, als ich das hier getan habe,27 und insbesondere zwischen der Handlung, dass Anna überhaupt dem Leiter mitteilt, dass Josephine die Stelle bekommen soll, und der Handlung, dass sie das gerade durch ihren Zuruf tut (und nicht mithilfe des Zettels), unterscheiden müssen. Wenn eine solche Unterscheidung nötig ist, dann wäre die erste Handlung zwar von Josephines sympathiebasiertem Wunsch rationalisiert (denn durch die Mitteilung ihrer Entscheidung stellte Anna sicher, dass dieser Wunsch realisiert wurde), aber, so ließe sich argumentieren, nicht die zweite Handlung (da es für die Realisierung des Wunsches gleichgültig war, auf welche spezifische Weise sie ihre Entscheidung mitteilte). Umgekehrt wäre nur die zweite Handlung durch Annas sympathiebasierten Wunsch erklärbar, und nur in dieser zweiten Handlung würde sich dieser Wunsch manifestieren. Denn auch wenn sie diesen Wunsch nicht gehabt hätte, hätte sie immer noch die gleiche Entscheidung getroffen und (in irgendeiner Weise) kommuniziert. Sobald wir also die Handlungen Annas hinreichend feinkörnig voneinander unterscheiden, hätten wir keinen Fall mehr, in dem sich in ein und derselbe Handlung ein Wunsch manifestiert, der diese Handlung rationalisiert, ohne dass dieser Wunsch auch den Ziel liefert, mit dem die Akteurin handelt.
Aber das vorgeschlagene Ausweichen auf feinkörnigere Handlungskonzeptionen (oder analog auf feinkörnigere Konzeptionen der Relata der Ursache-und Manifestationsbeziehungen) kann Fälle der dargestellten Art nicht lösen. Es ist zwar sicher richtig, dass Annas sympathisiebasierter Wunsch auch manche (feinkörnig individuierte) Handlungen rationalisiert, in denen er sich nicht manifestiert und umgekehrt. Aber damit das Beispiel ein Problem für die kausal-dispositionale Analyse bleibt, ist es ausreichend, dass es auch (feinkörnig verstandene) Handlungen gibt, für die die Rationalisierungs-und Manifestationsbedingung erfüllt sind, ohne dass die Akteurin gehandelt hat, um diesen Wunsch zu realisieren. Und letzteres scheint kaum bestreitbar (wenn wir an die Handlung denken, die darin besteht, dass Anna den entsprechenden Zuruf tut). In dieser Handlung hat sich Annas Wunsch - insbesondere nach den Maßstäben von Hymans Konzeption von Wünschen, die mir auch unabhängig recht plausibel erscheint - manifestiert, und zugleich ist diese Handlung, da sie, wie Anna wusste, ein Mittel zu einem von ihr gewünschten Zweck war, auch von diesem Wunsch rationalisiert.28
3.2. Alternativ könnte man bestreiten, dass es tatsächlich Annas sympathiebasierter Wunsch ist, der sich in ihrer Handlung manifestiert. Selbst wenn sich Annas Freude darüber, dass Josephine die Stelle bekommt, in einer Handlung manifestiert, so ließe sich einwenden, bedeutet das nicht, dass auch Annas sympathiebasierter Wunsch, der sich in dieser Freude manifestiert, seinerseits in der Handlung manifestiert. Denn die Manifestationsbeziehung ist nicht transitiv.29
Der letztere Punkt ist sicher generell richtig, da bei der Manifestation einer Disposition diese Disposition verloren gehen kann (z.B. beim Zerbrechen von Glas, wo wir die Verletzung an den scharfen Scherben kaum noch als Manifestation der urprünglichen Zerbrechlichkeit des Glases ansehen würden). Aber wenn kein solcher Verlust stattfindet und die Manifestation einer allgemeineren Disposition darin besteht, dass eine spezifischere Disposition für eine bestimmte Zeit hinzukommt, spricht prima facie sehr viel für die Annahme von Transitivität. Nehmen wir einen Charakterzug wie Jähzorn, dessen Manifestation im konkreten Fall darin bestehen kann, zu wünschen, eine andere Person wegen einer Beleidigung zu verletzen; letzterer Wunsch kann sich seinerseits in aggressiven Verhalten gegenüber dieser anderen Person manifestieren. Es ist völlig natürlich, dieses aggressive Verhalten nicht nur durch den spezifischen Wunsch, die andere Person zu verletzen, sondern auch durch die allgemeinere Disposition des Jähzorns zu erklären, und wir würden natürlicherweise das Verhalten als Manifestation beider Dispositionen ansehen.
3.3. Die ersten beiden Antwortmöglichkeiten haben sich an Hymans eigenem Vorschlag orientiert, der – wie Davidson – Wünsche als die relevanten kausalen Faktoren Handeln aus Gründen ansieht. Vielleicht liegt die Möglichkeit der genannten Problemfälle gerade in dieser letzteren Annahme und wir können die Devianz-Problematik hinter uns lassen, wenn wir auf andere Dispositionen als relevante Faktoren zurückgreifen?
Dies wird auch nahegelegt, wenn wir uns daran erinnern, was die oben skizzierten Fälle möglich gemacht hat. Dies war insbesondere, dass (1) sich der relevante mentale Faktor – also Wünsche – nicht ausschließlich darin manifestiert, dass die Akteurin handelt, um den Wunsch zu befriedigen, sondern auch in emotionalen Reaktionen, und (2) dass die zweite Manifestation ohne die erste auftreten kann (dass man sich also wegen eines Wunsches darüber freuen kann, X zu tun, auch wenn man X nicht tut, um diesen Wunsch zu realisieren). Für Wünsche erscheinen diese beiden Punkte plausibel – sollten wir daher nicht lieber auf andere mentale Faktoren zurückgreifen, für die dies nicht gilt?
Aber es ist alles andere als trivial, solche anderen Faktoren zu finden, die plausible Alternativen zu Wünschen wären, wie ich im Folgenden anhand von vier Optionen illustrieren möchte.
Als einfachste Lösung erscheint zunächst, einfach eine Disposition Wunsch* zu ‘definieren’, deren Manifestation nur in dem ersten der zwei von Hyman genannten Elemente besteht, während ihr ein emotionales Element fehlt (so dass der oben genannte Punkt (1) bereits nicht auftritt). (Ein Wunsch* nach x ist einfach die Disposition, Handlungen mit dem Ziel, x zu bekommen, auszuführen.) Dieser Zug hätte aber zwei offensichtliche Nachteile: Zum einen wäre eine Erklärung von Devianz bzw. eine kausale Analyse von Handeln aus Gründen, die auf eine solche Definition zurückgreift, vollkommen trivial bzw. zirkulär (da per definitionem die einzige Manifestation in einer entsprechenden zielgerichteten Handlung besteht). Zum andern sollte eine befriedigende Analyse von Handeln aus Gründen das Verhältnis dieses Phänomens zu anderen Phänomenen der Alltagspsychologie darstellen, und die Zustände, auf die wir bei alltäglichen Handlungserklärungen zurückgreifen, haben typischerweise sowohl einen emotionalen als auch einen teleologischen Aspekt. (Das ist auch nicht weiter verwunderlich, da unser Charakter als rationale, zielverfolgende Akteure unlösbar mit unserem Charakter als emotionale Wesen verbunden ist.)
Auch wenn es daher nicht erfolgsversprechend ist, eine Disposition zu postulieren, bei der der emotionale Aspekt völlig fehlt, so gibt es zumindest Dispositionen, bei denen Punkt (2) nicht auftreten kann, nämlich insbesondere Handlungsabsichten. Auch Absichten haben zwar vermutlich einen emotionalen Aspekt: man ist normalerweise enttäuscht, wenn man nicht erreicht, was man beabsichtigt; und vielleicht gibt es entsprechend auch ‘Erfolgsgefühle’ bei Verwirklichung einer Absicht. Aber dieser emotionale Aspekt kann nicht unabhängig von der Erreichung bzw. dem Scheitern der Erreichung des Ziels, das den Gegenstand der Absicht bildet, auftreten. Denn anders als bei Wünschen gehört zu den Erfolgsbedingungen einer Absicht nicht nur, dass ein bestimmtes Ergebnis auftritt, sondern es muss als Ergebnis ebendieser Absicht auftreten. Wenn ich die Absicht habe, heute Abend zum Ufer des Sees zu spazieren, dann wird diese Absicht nur realisiert, wenn ich in Ausführung dieser Absicht zum Seeufer gehe; es genügt nicht, dass ich ziellos losgehe, mich verlaufe, und dabei zufällig am Seeufer ende. Sogar wenn es also ‘Erfolgsgefühle’ bei der Befriedigung einer Absicht geben sollte, kann eine Absicht nur die Disposition einschließen, diese Gefühle zu haben, wenn man in Ausführung dieser Absicht gehandelt hat – und damit scheinen Fälle wie der in Abschnitt 2. präsentierte für Absichten nicht konstruierbar, weil die verschiedenen Manifestationen nicht in der erforderlichen Weise auseinanderfallen können.
Aber auch der Rückgriff auf Absichten kann, soweit ich sehe, die kausal-dispositionale Analyse nicht retten, da er das Problem bestenfalls verschiebt. Denn wir führen nicht nur Handlungen aus Gründen aus, sondern bilden und haben auch Absichten aus Gründen. Absichten werden aber in der Regel nicht auf Grundlage schon vorhandener anderer Absichten gebildet (auch wenn das manchmal vorkommt), sondern auf Grundlage von vorherigen Wünschen der Akteurin. Wenn ich die Absicht bilde, morgen ins Kino zu gehen, tue ich das normalerweise nicht deshalb, weil ich etwas anderers beabsichtige, sondern einfach weil ich einen bestimmten Film sehen will und glaube, dass dieser dort läuft. Diese Fälle müssten wir dann, wenn wir an der kausalen Analyse festhalten, vermutlich wiederum so verstehen, dass die Absicht von einem Wunsch-und-Überzeungs-Paar verursacht wird – und dabei tritt das alte Problem devianter Kausalketten erneut auf, weil auch die Absicht von dem betreffenden Paar ‚in der falschen Weise‘ verursacht sein kann. Und auch hier scheint die dispositionale Analyse das Problem nicht vollständig beheben zu können; denn wir können auch bzgl. der Absichtsbildung Fälle wie den unserer Dirigentin Anna aus Abschnitt 2. finden. (Wir müssen uns z.B. nur vorstellen, dass Anna vor der Mitteilung an den Leiter in den Nebenraum gehen muss. Aufgrund ihrer Freude kommt ihr direkt die Art der enthusiastischen Mitteilung durch den Zuruf in den Sinn, so dass sie spontan auf dem Weg zum Nebenraum die Absicht bildet, dem Leiter zuzurufen, dass Josephine den Platz bekommen soll.) Wir brauchen daher auch für Absichten eine Lösung für diese Fälle von kausaler Devianz, und die Bedingung, dass die Absichtsbildung eine Manifestation des entsprechenden Wunsches sein muss, ist dafür, wie gesehen, nicht ausreichend.
3.4. Die bisher betrachteten Vorschläge hatten gemeinsam, dass sie als die relevanten Dispositionen mentale Zustände identifiziert haben, die wir als im weiteren Sinne motivierende Faktoren für die Handlung ansehen können und als solche in alltäglichen Gründe-Erklärungen nennen. Vielleicht ist es jedoch erforderlich, zusätzliche Vermögen als ‘Vermittler’ zwischen dem Motiv und der Handlung heranzuziehen, die den Übergang zwischen beiden sicherstellen und sich in diesem Übergang manifestieren müssen, wenn eine nicht-deviante Verursachung der Handlung vorliegen soll. Ein derartiger Vorschlag findet sich z.B. bei Mantel (2017) für den speziellen Fall des Handelns aus guten Gründen,30 wenn sie vorschlägt, “that an agent acts for a the normative reason that p only if the action is the manifestation of the agent’s disposition to do what normative reasons (of the relevant kind) favour” (2017, 562). Wenn wir diesen Vorschlag generalisieren für den Fall des Handelns aus Gründen im Allgemeinen, so würde er in etwa ergeben: ‘Ein Akteur handelt aus dem Grund, dass p, wenn seine Handlung eine Manifestation seiner Disposition ist, dass zu tun, wofür p sprechen würde, wenn p tatsächlich einen guten Grund darstellen würde zu handeln.’ Die beschriebene Disposition müsste dann in der Handlung manifestiert sein, wenn der Wunsch des Akteurs sein Tun nicht-deviant verursachen soll.31
Aber beim Rückgriff auf eine solche – oder ähnlich gestaltete – Disposition sehen sich Kausalisten32 vor die Wahl zwischen zwei gleichermaßen unangenehmen Alternativen gestellt. Sie können einerseits die fragliche Disposition sehr generell beschreiben – so wie in der oben vorgeschlagenen Formulierung. Das hat den Vorteil, dass dadurch die Analyse von kausaler Devianz einen echten Erklärungswert hat und Zirkularität vermieden wird (dass wir also das Problem kausaler Devianz nicht nur deshalb ausschließen, weil die Definition der Disposition von vornherein alle Fälle, die nicht Handlungen aus dem richtigen Grund sind, als Manifestationen ausschließt). Es hat jedoch den Nachteil, dass dann Fälle wie der von unserer Dirigentin Anna nicht offensichtlich ausgeschlossen sind. Denn die emotionale Reaktion Annas ist ja nicht einfach ein irrationaler Reflex: Für diese Reaktion spricht aus Sicht ihres Wunsches, Josephine möge die Stelle bekommen, etwas und sie ist im Lichte dieses Wunsches durchaus vernünftig. Menschen mit einem ‘normalen’ Gefühlshaushalt freuen sich eben darüber, wenn sie etwas tun können, was sie auch gerne tun wollen. Die emotionale Reaktion – und ihr späterer Ausdruck in Annas Verhalten – ist daher auch etwas ‘that would be favoured by p’.
Um dieses ungewünschte Resultat zu vermeiden, muss man die relevante Disposition enger fassen, und sie z.B. auf eine Disposition zu zielgerichtetem Verhalten, das auf p ausgerichtet ist, einschränken. Falls wir dabei nur spezifisch genug werden, können wir die Problemfälle sicher ausschließen. Aber, wie wir in Abschnitt 1. gesehen haben, die klassische Motivation für die Einführung der kausalen Analyse war ja im Anschluss an Davidsons Argument aus ‘Actions, Reasons, and Causes’ eine bestimmte Erklärungshoffnung: Dass diese Analyse den Unterschied zwischen ‘einen Grund nur zu haben’ und ‘aus diesem Grund zu handeln’ besonders gut erklären könnte. Sobald wir in die Beschreibung der relevanten Dispositionen hineinstecken, dass deren Manifestation ein zielgerichtetes Verhalten in Verfolgung eines bestimmten Ziels involvieren muss, müssen wir dieses Erklärungsziel aufgeben und unsere Analyse wird zirkulär. Die in diesem Unterabschnitt beschriebene kausale Strategie wäre daher nur erfolgreich, wenn sich ein gangbarer Mittelweg bzgl. der Spezifierung finden ließe. Aber die Aussichten dafür erscheinen mir nicht allzu gut.33
4. Konklusion
Das Problem kausaler Devianz in der Handlungstheorie wird daher, so steht zu befürchten, durch den Übergang zu einer dispositionalen Interpretation kausaler Theorien nicht verschwinden. Es werden weiterhin Formen von Devianz möglich sein, bei denen sich die einschlägige Disposition ‘in der falschen Weise’ in der Handlung manifestiert. Der tieferliegende Grund dafür liegt wohl in der Attraktivität des dispositionalen Grundschemas selbst. Denn so attraktiv dieses Schema für die Erklärung von Handeln aus Gründen ist, so attraktiv ist es auch für die Erklärung von Überzeugungen, Urteilen, Emotionen etc., die wir aus Gründen haben oder bilden. Emotionen sind aber ihrerseits Dispositionen zu weiterem Verhalten, und sobald sie sich in zielgerichteten Handlungen oder der Art ihrer Durchführung manifestieren können, besteht die Gefahr, dass sich Konflikte der dargestellten Art mit der dispositionalen Analysen von Handeln aus Gründen ergeben. Insofern droht die dispositionale Analyse für bestimmte Phänomene zu einem Opfer ihrer eigenen Attraktivität zu werden – und diese Art von Problem bei der Ausarbeitung eines Ansatzes ist ja in gewisser Weise ein Kompliment für diesen Ansatz.