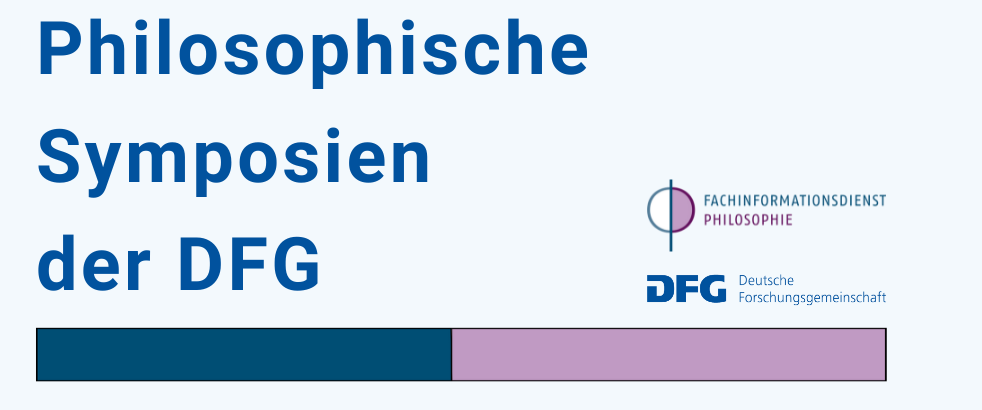Zurechenbarkeit potentiellen und nicht-potentiellen Wissens bei Aristoteles
Zurechenbarkeit potentiellen und nicht-potentiellen Wissens bei Aristoteles
Einleitung
Das Thema meines Beitrages ist die aristotelische Auffassung der Zurechenbarkeit von potentiellem und nicht-potentiellem Wissen. Die Frage nach der Zurechenbarkeit von Wissen ist dabei vornehmlich in Bezug auf die Zurechenbarkeit von Handlungen und das dafür relevante Wissen zu verstehen, d.h. die Frage, ob ein bestimmtes potentielles oder nicht-potentielles Wissen einer Person zuzurechnen ist, stellt sich in der Regel bzw. stellt sich in dem spezifischen Sinn, der mich hier interessiert, im Hinblick auf Handlungen, für die Beurteilung von deren Zurechenbarkeit das relevante handlungsbezogene Wissen eine substantielle Rolle spielt.
Bemerkenswert an Aristoteles’ Position ist, dass er offenbar angenommen hat, dass es erstens in bestimmten Fällen für die Zurechenbarkeit von Handlungen ausreicht, dass die handelnde Person nur über potentielles, mithin nicht über aktualisiertes Wissen verfügt, und dass es für ihn zweitens bisweilen sogar denkbar ist, dass einer Person eine Handlung zuzurechnen ist, wenngleich sie nicht einmal über relevantes handlungsbezogenes potentielles (und eo ipso nicht über aktualisiertes) Wissen verfügt, und zwar dann, wenn es sich bei dem fehlenden Wissen entweder um notwendiges oder um einfach zu erwerbendes Wissen handelt und es auf ein charakterliches Defizit der Person zurückzuführen ist, dieses Wissen nicht erworben zu haben. Diese subtile Differenzierung hinsichtlich der Bedingung, welche Art von Wissen notwendig ist für willentliches Handeln, unternimmt Aristoteles nur in der Eudemischen Ethik, und sie geht deutlich über das hinaus, was er im Kontext der klassischen Erläuterung der Wissensbedingung im dritten Buch der Nikomachischen Ethik sagt.
Ziel meines Beitrages ist es, die aristotelische Konzeption der Zurechenbarkeit von potentiellem und nicht-potentiellem Wissen, wie sie sich Kapitel 9 des zweiten Buches der Eudemischen Ethik entnehmen lässt, textnah zu rekonstruieren und historisch einzuordnen. Anschließend werde ich einige in meinen Augen wichtige Punkte dieses Verständnisses der Zurechenbarkeit von potentiellem und nicht-potentiellem Wissen diskutieren. Schließlich werde ich ausgewählte Beispiele, die bei Aristoteles zu finden sind (akratische Handlungen und Fehler (hamartiai/hamartêmata)), zur Illustration und weiteren Diskussion der Konzeption heranziehen. Dies könnte eine Grundlage bieten, um nach der Anschlussfähigkeit der aristotelischen Konzeption für aktuelle Diskussionen zu fragen.
Unwissenheit als Ausschlussbedingung für Willentlichkeit
Für die aristotelische Konzeption der Zurechnung spielt der Begriff des Wissens eine zentrale Rolle. Aristoteles entwickelt seine Auffassung von Zurechenbarkeit im Kern in den Kapiteln 1-8 von Buch III der Nikomachischen Ethik (EN) und in der Parallelpassage in der Eudemischen Ethik (EE), den Kapiteln 7-11 des zweiten Buches der EE. Er geht in beiden Passagen so vor, dass er zunächst Willentlichkeit bestimmt, und anschließend erläutert, was darüber hinaus erforderlich ist, damit eine Handlung – und im weiteren Sinne auch Emotionen und der Charakter – nicht nur willentlich, sondern zurechenbar sind.1 Willentlichkeit bestimmt Aristoteles dabei in Abgrenzung zu Unwillentlichkeit, d.h. er bestimmt zuerst, welche Faktoren dazu führen, dass eine Handlung unwillentlich geschieht: Eine Handlung ist unwillentlich, wenn sie entweder aus Gewalt (bia) bzw. unter Zwang (anankê) erfolgt oder wenn sie in Unwissenheit um die Einzelumstände der Handlung geschieht. Gewalt bzw. Zwang oder Unwissenheit um die Einzelumstände der Handlung sind also Ausschlusskriterien für die Willentlichkeit von Handlungen. Diese Faktoren können bewirken, dass eine Handlung nicht willentlich geschieht und damit a fortiori nicht zurechenbar ist; sie haben vielmehr häufig zur Folge, dass die handelnde Person Entschuldigung oder zumindest Nachsicht für ihr Handeln verdient und in der Regel auch erhält. Liegt hingegen keine solche Entschuldigungsbedingung vor, so scheint eine Handlung willentlich zu erfolgen. Dies ist allerdings allein noch nicht hinreichend, damit die Handlung der handelnden Person auch als ihre zuzurechnen ist. Ein Grund, den Aristoteles dafür anführt, weswegen Willentlichkeit in diesem Sinn noch nicht ausreichend ist für die Zurechenbarkeit einer Handlung, lautet, dass diese Art von Willentlichkeit auch durch die Handlungen und Verhaltensweisen von Tieren und Kindern erfüllt wird, während dafür, dass eine Person für ihre Handlung zu Recht im vollen Sinn zur Verantwortung gezogen wird (etwa indem sie dafür gelobt oder getadelt wird), die Handlung Aristoteles zufolge in der Regel darüber hinaus auf einem Entschluss (prohairesis) beruhen muss, der aus einer Überlegung (bouleusis), ausgehend von einem Wunsch (boulêsis), hervorgegangen ist.
Aristoteles’ nähere Erläuterung des Ausschlusskriteriums der Unwissenheit in der Nikomachischen Ethik macht deutlich, dass er nur eine bestimmte Art von Unwissenheit als angemessene Entschuldigungsbedingung ansieht. Er grenzt diese von anderen Formen der Unwissenheit ab, deren Vorliegen nicht dazu führt, dass eine Person Nachsicht oder Entschuldigung für ihr Handeln verdient. Der locus classicus für die Erklärung, welche bestimmte Art von Unwissenheit nur dazu geeignet ist, eine Handlung unwillentlich und damit nicht zurechenbar zu machen, findet sich in EN III 2. Hier führt Aristoteles den Unterschied ein zwischen Handlungen, die aufgrund von Unwissenheit erfolgen, und Handlungen, die in Unwissenheit geschehen. Unwillentlich und infolgedessen entschuldbar sind nur Handlungen, die aufgrund von nicht-selbstverschuldeter Unwissenheit um mindestens einen relevanten Faktor der Handlungssituation geschehen sind. Keine Entschuldigung verdienen demgegenüber Handlungen, die in Unwissenheit geschehen, d.h. unwissentliche Handlungen, bei denen der Zustand der Unwissenheit selbst-verschuldet ist, so dass der Mangel an Wissen der handelnden Person zuzuschreiben ist, wie im Fall von Handlungen in Trunkenheit oder bei Handlungen in Unwissenheit um das moralisch Richtige, das jeder kennen sollte und dessen Unkenntnis nicht zu entschuldigen ist.2
Die Wissensbedingung in der EE
Weniger Aufmerksamkeit als die Behandlung der Wissensbedingung in der EN erfährt meist die Erörterung der Entschuldigungsbedingung der Unwissenheit in der kurzen Parallelstelle in EE II 9. Ich unterteile das kurze Kapitel 9 in zwei Abschnitte, von denen der erste zwar Ähnlichkeit mit den Ausführungen in der EN aufweist, aber auch einige erwähnenswerte Abweichungen enthält, während der zweite sich insofern noch sehr viel deutlicher abhebt, als er weitere Differenzierungen enthält, die in der EN nicht vorkommen, und zwar die Unterscheidung zwischen potentiellem und nicht-potentiellem Wissen und deren jeweilige Bedeutung im Hinblick auf die Zurechenbarkeit einer entsprechenden Handlung.
Im ersten Abschnitt von EE II 9 unterscheidet Aristoteles zunächst anhand des Kriteriums, ob die Handlung aufgrund einer bestimmten Art von Unwissenheit geschehen ist oder nicht, zwischen willentlichen und unwillentlichen Handlungen:
[EE II 9, 1225a36-b8]
Da diese Untersuchung also ein Ende hat, und das Willentliche weder als Streben noch als Entschluss bestimmt wurde, bleibt somit übrig, das zu bestimmen, was gemäß dem Denken ist. Das Willentliche scheint dem Unwillentlichen entgegengesetzt zu sein, und 〈zu handeln〉, während man weiß, wem gegenüber oder womit oder worumwillen (denn manchmal weiß man, dass es der Vater ist, aber man handelt, nicht um zu töten, sondern um zu heilen, wie im Fall der Töchter des Pelias; oder man kennt das Womit, dass dies ein Getränk ist, aber man 〈behandelt〉 es als Liebestrunk und Wein, während es 〈tatsächlich〉 ein Schierlingstrunk war) ist dem Fall entgegengesetzt, 〈zu handeln〉, während man nicht weiß, wem gegenüber und womit und was 〈man tut〉, aufgrund von Unwissenheit, nicht akzidentellerweise. Was aber aufgrund von Unwissenheit über das was und womit und wem gegenüber 〈getan wird〉, ist unwillentlich. Das Entgegengesetzte ist also das Willentliche.3
Handelt jemand aufgrund von Unwissenheit entweder darüber, wem gegenüber, womit oder worumwillen er handelt, so ist diese Handlung laut Aristoteles unwillentlich. Um willentlich zu handeln, ist es dagegen nötig, dass die handelnde Person weiß, wem gegenüber, womit und worumwillen sie handelt. Diese Beschreibung scheint mit der Behandlung in der EN übereinzustimmen, auch wenn Aristoteles in der EE nur drei der sechs Hinsichten aus der EN, in Bezug auf welche jemand unwissend sein kann, so dass man unwillentlich handelt, nennt, was ich aber bloß als Fokussierung auf die wichtigsten Hinsichten auffasse.4
Stutzig machen dagegen die Beispiele, die Aristoteles in der EE anführt. Er fügt die Beispiele in einer Art Parenthese, die im Oxford Classical Text sowie in meiner Übersetzung in Klammern gesetzt ist, zwischen die Beschreibung der willentlichen Handlungen (vor dem Einschub) und die Charakterisierung der unwillentlichen Handlungen (nach dem Einschub) ein. Das Irritierende an den beiden Beispielen ist, dass sie Fälle illustrieren, bei denen die handelnde Person eine bestimmte Hinsicht ihrer Handlung kennt, während sie sich zugleich in einer anderen relevanten Hinsicht in Unwissenheit befindet. Das bedeutet, dass die Beispiele sich auf den ersten Blick sowohl als Illustrationen für willentliche Handlungen als auch als Beispiele für unwillentliche Handlungen verstehen lassen – und dieser Eindruck wird nochmals dadurch verstärkt, dass die Beispiele eingebettet sind zwischen den jeweiligen Beschreibungen von willentlichen und unwillentlichen Handlungen. Prima facie könnte es naheliegen, die Fälle als Illustrationen willentlicher Handlungen aufzufassen, da sie direkt auf die Charakterisierung willentlicher Handlungen folgen und der Satz in der Klammer mit „eniote gar oide“ (= „denn manchmal weiß man“) beginnt, worauf als erstes eine Hinsicht genannt wird, in der Wissen vorliegt, nämlich wem gegenüber gehandelt wird. Allerdings führt der folgende adversative Teil des Satzes eine Hinsicht an, in Bezug auf welche Unwissenheit vorliegt. Die Töchter des Pelias wissen zwar, dass ihr Vater das Gegenüber ihrer Handlung ist, sie sind aber unwissend um das Worumwillen ihrer Handlung. Medea hat dem Mythos zufolge die Töchter des Pelias überzeugt, dass sie ihren Vater verjüngen können, indem sie ihn zuerst zerteilen und die Stücke anschließend kochen. Und weil die Töchter Medeas Prognose Glauben schenken, sind sie unwissend darüber, dass die Handlung des Zerstückelns und Kochens einer Person den Zweck hat, die Person zu töten.
Die Deutung dieses Beispiels hängt freilich wesentlich davon ab, welche Version des Peliadenmythos man zugrunde legt. So enthalten zahlreiche textliche und auch darstellerische Überlieferungen der Geschichte ein zusätzliches Moment, das bei Aristoteles’ Erwähnung des Mythos in EE II 9 fehlt: Meist wird berichtet, Medea demonstriere den Töchtern des Pelias ihre Behauptung, das Kochen und Zerstückeln diene der Verjüngung, zur Untermauerung zunächst an einem Widder. Dies veränderte den Mythos im Hinblick auf die Zurechenbarkeit des Handelns der Töchter ganz erheblich, da die zusätzliche Evidenz Medeas Überredung deutlich mehr Glaubhaftigkeit verliehe, als sie ihrer puren Prophezeiung anhaftete. Da in Aristoteles’ Erwähnung der Geschichte in EE II 9 einerseits jeglicher Hinweis auf den Widder fehlt, dieser andererseits sachlich sehr bedeutsam wäre, gehe ich in meiner Interpretation davon aus, dass für die Frage, ob und inwieweit von den Töchtern Wissen um den Zweck des Kochens und Zerstückelns einer Person erwartet werden kann, nicht von dem zusätzlichen Beleg anhand des Beispiels des Widders auszugehen ist. Ich komme später noch einmal auf diesen Punkt zurück.
Auch beim zweiten Beispiel in EE II 9 wird sowohl eine Hinsicht erwähnt, in Bezug auf welche Wissen vorliegt, als auch eine andere Hinsicht, über die sich die handelnde Person in Unwissenheit befindet. Die handelnde Person kennt zwar in allgemeiner Weise das Womit ihrer Handlung, da sie weiß, dass es sich um ein Getränk handelt; der folgende adversative Teil des Satzes gibt aber an, inwiefern die Person etwas Besonderes an dem Womit ihrer Handlung nicht weiß: es fehlt ihr an der spezifischen Kenntnis der Art des Getränks, worauf ihre Handlung bezogen ist. Für ihr Handeln ist es nicht nur relevant, dass es sich bei dem Womit ihrer Handlung um ein Getränk handelt, sondern entscheidend ist, ob es sich bei dem Getränk um Wein handelt, der geeignet ist, als Liebestrank zu dienen, oder ob es ein Gift ist.
Die beiden Beispiele sind somit dazu geeignet, zugleich willentliches wie unwillentliches Handeln zu illustrieren. Dies unterscheidet sie deutlich davon, wie Aristoteles in der EN die verschiedenen Einzelhinsichten, bezüglich welcher Unwissenheit vorliegen kann, präsentiert, da sie ausschließlich Fälle veranschaulichen sollen, bei denen die vorliegende Unwissenheit die Unwillentlichkeit der Handlungen begründet. Die Beispiele in der EE sind dagegen komplizierter, weil Aristoteles sie nicht eindeutig als Beispiele für unwillentliche Handlungen, die aufgrund von Unwissenheit um eine bestimmte Einzelhinsicht geschehen, anzusehen scheint.
Es ist zu bezweifeln, dass Aristoteles es als angemessene Entschuldigung für den Vatermord der Töchter des Pelias akzeptierte, dass sie sich von Medea davon haben überzeugen lassen, Zweck des Zerstückelns und des Kochens ihres Vaters sei es, ihn auf diese Weise zu verjüngen, und Ziel dieses Tuns sei es nicht, ihn dadurch zu töten. Ein Hinweis darauf, dass Aristoteles eine derartige Entschuldigung abwiese, ist das Beispiel des Alkmaion, das er im Zusammenhang der sog. „gemischten Handlungen“ (d.h. Handlungen, die unter Zwang geschehen und die deswegen auf eine Art als unwillentlich erscheinen, weil sie ungern getan werden, die aber letztlich willentlich sind, da die Bewegungsursache in der handelnden Person liegt und diese wissentlich handelt) in EN III 1 behandelt:
In manchen Fällen jedoch gibt es vielleicht kein Gezwungen-Werden, sondern man sollte eher die schlimmsten Dinge ertragen und den Tod auf sich nehmen. Denn die Dinge, die z.B. den Alkmaion des Euripides gezwungen haben, Muttermord zu begehen, erscheinen lächerlich.5
Aristoteles führt den Fall des Alkmaion an, um zu illustrieren, dass es derart schlimme Handlungen gibt, dass man sie unter keinen Umständen tun soll, sondern eher das Schlimmste wie den eigenen Tod hinnehmen. Die schlimme Handlung, zu der Alkmaions Vater ihn durch Androhung schlimmer Folgen zu zwingen versuchte, ist, Muttermord zu begehen. Mit diesem Beispiel gibt Aristoteles m.E. zu erkennen, dass er einige wenige besonders schlimme Handlungen als schlechthin tadelnswerte Handlungen ansieht, die zu tun unter keinen Umständen erlaubt ist, sondern die vielmehr schlechthin verboten sind.
Der Vergleich der Beispiele des Alkmaion und der Töchter des Pelias spricht dafür, dass letzteres nach Aristoteles ebenfalls keinen Fall einer unwillentlichen Handlung aufgrund von Unwissenheit, die Entschuldigung verdient, darstellen soll. Meine Vermutung, was der Grund gewesen sein könnte, dass er in der EE uneindeutige und diskussionswürdige Beispiele für Handlungen aufgrund von Unwissenheit gibt, ist, dass deren janusköpfiger Charakter sich für den Fortlauf des Textes als wichtig erweist.
Nicht-entschuldbare Formen der Unwissenheit
Im zweiten Teil von EE II 9 folgen mit der Unterscheidung von potentiellem und nicht-potentiellem, aber notwendig oder einfach zu erwerbendem Wissen genau diejenigen theoretischen Differenzierungen, mit deren Hilfe sich erklären lässt, weshalb Handlungen aufgrund von Unwissenheit um die Einzelumstände der Handlung trotz der Unwissenheit der handelnden Person keine Entschuldigung verdienen:
Was also jemand nicht in Unwissenheit und durch sich selbst tut, wenn es auch bei ihm liegt, nicht zu handeln, dann geschieht das notwendigerweise willentlich, und dies ist das Willentliche. Was man in Unwissenheit und aufgrund von Unwissenheit tut, ist unwillentlich. Da aber Wissen und Verstehen zweierlei Art sind, das eine das Haben, das andere das Gebrauchen des Wissens, mag derjenige, der es hat, aber nicht gebraucht, auf eine Weise zu Recht unwissend genannt werden, auf eine andere Weise aber auch zu Unrecht, z.B. wenn er es aufgrund von Nachlässigkeit nicht gebrauchte. Ebenso würde auch derjenige getadelt, der es nicht einmal hat, wenn das Wissen, das er nicht hat, leicht oder notwendig war und er es aufgrund von Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz nicht hat. Dies also ist der Definition hinzuzufügen.6
Aristoteles führt hier im zweiten Satz eine Differenzierung von zwei Arten von Wissen ein, die in der Behandlung der Unwissenheit in EN III 2 nicht explizit vorkommt.7 Die Unterscheidung zwischen dem Haben von Wissen und dem Gebrauchen von Wissen ist vermutlich an Platons Taubenschlag-Modell im Theätet angelehnt.8 Bezüglich der Unterscheidung zwischen dem Haben und dem Gebrauchen sagt Aristoteles hier, dass eine Person, die nur über potentielles Wissen verfügt, auf eine Weise „zu Recht“ unwissend genannt wird, zugleich aber auf eine andere Weise auch „zu Unrecht“ als unwissend bezeichnet wird, nämlich dann, wenn sie ihr Wissen z.B. aufgrund von Nachlässigkeit nicht gebraucht. Wird eine Person zu Unrecht unwissend genannt, so hat dies Folgen für die Lobens- bzw. Tadelnswürdigkeit ihrer Handlung. Es fällt auf, dass Aristoteles an dieser Stelle nichts darüber sagt, ob eine Person in solchen Fällen willentlich oder unwillentlich handelt. Stattdessen qualifiziert er eine solche Handlung, die in einer derartigen Art von Unwissenheit erfolgt, dass die Person auf eine Weise zu Unrecht als unwissend bezeichnet wird, näher als tadelnswerte Handlung.
Daraus scheint sich das Bild zu ergeben, dass Aristoteles hier nicht von einer erschöpfenden Einteilung in willentliche und unwillentliche Handlungen ausgeht, sondern darüber hinaus Handlungen annimmt, die weder willentlich noch unwillentlich sind. Weder willentlich noch unwillentlich handelt eine Person, wenn sie in Unwissenheit handelt und diese Unwissenheit ihr zuzurechnen ist, z.B. wenn ihre Unwissenheit um die Einzelumstände der Handlung auf ihrer Nachlässigkeit beruht. Die Person verdient dann keine Entschuldigung, weil es auf ihr eigenes Verschulden zurückzuführen ist, dass sie nicht über das relevante Wissen verfügt. Dies verdeutlicht, dass es für zurechenbares Handeln nicht in jedem Fall notwendig ist, dass die handelnde Person über aktuales Wissen von der Handlungssituation verfügt; vielmehr kann es für die Lobens- oder Tadelnswürdigkeit einer Person für ihr Handeln ausreichen, dass sie nur über potentielles Wissen verfügt, dieses aber aus Nachlässigkeit nicht aktualisiert.
Im folgenden Satz („Ebenso würde auch derjenige getadelt,...“) geht Aristoteles noch einen Schritt weiter, indem er zu erkennen gibt, dass er es bisweilen noch nicht einmal als notwendig für tadelnswertes Handeln ansieht, dass die handelnde Person über potentielles Wissen verfügt. Wenn es sich um Wissen handelt, das entweder leicht oder notwendig zu haben gewesen wäre und über das die handelnde Person aufgrund von Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz nicht verfügt, so vertritt er die Auffassung, dass das Fehlen solchen Wissens nicht ausreicht, damit die Person für ihr Handeln zu entschuldigen ist.
Dabei fasse ich die Kriterien, die Aristoteles hier für die Möglichkeit aufzählt, dass eine Handlung trotz Mangels an potentiellem handlungsrelevantem Wissen nicht entschuldbar ist, folgendermaßen auf: Während die Bedingungen, dass ein solches Wissen notwendig oder einfach zu erwerben ist, disjunktiv zu verstehen sind, sind sie jeweils nur zusammen mit einem der genannten Kriterien für einen möglichen Grund für den Mangel an derartigem Wissen (Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz) hinreichend, damit darauf beruhende Handlungen oder Handlungsfolgen zurechenbar sind. Das heißt, es genügt nicht, dass es einer Person an notwendigem oder einfach zu erwerbendem Wissen mangelt, damit sie für ihre schlechte Handlung Tadel verdient, sie muss es zusätzlich aus Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz versäumt haben, sich dieses Wissen anzueignen.
Diskussionspunkte zu zurechenbarem potentiellem und nicht-potentiellem Wissen
Um die aristotelische Position genauer zu verstehen, möchte ich drei Punkte näher diskutieren: (i) Was heißt es, dass eine Person über potentielles Wissen verfügt, dieses aber nicht anwendet und daher auf eine Weise „zu Unrecht“ als unwissend bezeichnet wird? Eine Antwort möchte ich zunächst in Form eines Beispiels geben; später werde ich in Bezug auf akratische Handlungen nochmals auf diesen Punkt zurückkommen. (ii) Was ist nach Aristoteles unter Wissen zu verstehen, das leicht zu erwerben ist und/oder notwendig ist? Diese Frage will ich ausgehend vom Peliadenmythos beleuchten. (iii) Weshalb gilt es nach Aristoteles nicht als Entschuldigung, wenn eine Person aufgrund von Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz potentielles Wissen nicht gebraucht oder notwendige und einfaches Wissen nicht besitzt? Hierfür wird sich Aristoteles’ Ansicht des Charaktererwerbs als zentral erweisen.
Zu (i): Was heißt es, dass eine Person über potentielles Wissen verfügt, dieses aber nicht anwendet? Denken wir uns als einfaches Beispiel einen Gast auf einer Party, der sich, ohne weiter darüber nachzudenken, bei den alkoholischen Getränken bedient, obwohl er mit dem Auto unterwegs ist und allgemein (katholou) weiß, dass er nur nüchtern Auto fahren soll. Dieser Partybesucher handelt nachlässig und wird deswegen zu Unrecht unwissend genannt, obwohl er nicht schlechthin (haplôs) weiß, dass er ein alkoholisches Getränk wählt, bevor er mit dem Auto nach Hause fährt. Das allgemeine Wissen des Partygastes besteht darin, dass er weiß, dass er wegen des Autofahrens nichts Alkoholisches trinken sollte; er ruft dieses Wissen sogar bei der Wahl seines Getränks auf und sieht sich nach einem alkoholfreien Bier um. Dass er trotzdem ein fünfprozentiges Bier ergreift, liegt daran, dass er entweder nicht weiß, dass die gewählte Sorte nicht alkoholfrei ist, oder dass er aus Unachtsamkeit nicht auf den Alkoholgehalt achtet. Andernorts (dazu später mehr) drückt sich Aristoteles in einer Weise aus, wonach der Partygast nicht schlechthin bzw. ohne Qualifikation (haplôs) weiß, dass er etwas Alkoholisches trinkt. Wüsste er dies schlechthin, so subsumierte er den konkreten Fall zusätzlich unter sein allgemeines Wissen, d.h. er wüsste auch, dass der Inhalt derjenigen Flasche, die er auswählt, alkoholhaltig ist oder nicht. Der Partygast ist daher für seine Handlung zu tadeln, weil es zum einen auf seine Nachlässigkeit zurückzuführen ist, dass er nicht schlechthin weiß, dass er etwas Alkoholisches trinkt; zum anderen fehlt dem Partygast leicht zu erwerbendes Wissen, das zu besitzen und in einschlägigen Situationen auch zu aktualisieren überdies von jedem umsichtigen Autofahrer erwartet werden kann. Der biertrinkende Gast hat frei und leicht zugängliche Informationen aus Gleichgültigkeit ignoriert, so dass er sich nicht zu Recht auf seine Unwissenheit zur Entschuldigung berufen kann.
Auch das Beispiel der Töchter des Pelias lässt sich mithilfe der Differenzierungen des handlungsrelevanten Wissens genauer deuten. Nach der Version des Mythos, wie sie Aristoteles’ Erwähnung zu entnehmen ist, fehlt den Töchtern notwendiges und möglicherweise auch leicht verfügbares Wissen, nämlich das Wissen darum, welchem Zweck das Zerstückeln und Kochen einer Person für gewöhnlich dient: Zweck dieses Tuns ist nicht die Verjüngung, sondern vielmehr das Töten einer Person. Dass die Töchter dies in der konkreten Situation nicht wissen, sondern Medea leichtfertig Glauben schenken, beruht auf dem ihnen anzulastenden Versäumnis, sich nicht in Kenntnis über den eigentlichen Zweck dieses Tuns gesetzt zu haben.
Hier stellt sich die Frage, ob und ggf. inwiefern es möglich ist, dass eine Person über Ziel und Zweck ihres Tuns unwissend ist. Es erscheint psychologisch unmöglich, dass eine Person eine Handlung vollzieht, ohne das Ziel zu kennen, das sie mit ihrer Handlung zu erreichen beabsichtigt. Viele Kommentatoren gehen daher davon aus, dass mit dem Worumwillen in EE II 9 nicht der Zweck bzw. das Ziel einer Handlung gemeint sein kann, sondern dass Aristoteles damit auf das Resultat einer Handlung Bezug nimmt.9 Ein origineller Vorschlag, inwiefern tatsächlich doch das Worumwillen einer Handlung gemeint sein könnte, stammt von Hendrik Lorenz10. Er geht davon aus, dass Aristoteles zwischen zwei verschiedenen Arten von Zielen bzw. Zwecken von Handlungen unterscheidet, die Lorenz als psychologische und als natürliche Ziele bezeichnet. Ein psychologisches Ziel ist das, was üblicherweise unter dem Worumwillen einer Handlung verstanden wird. Es ist das Ziel, um dessentwillen sich eine Person de facto zu einer Handlung entschließt. Ein natürliches Ziel haben Handlungen dagegen aufgrund ihrer Natur bzw. aufgrund der Umstände, in denen sie geschehen. Zwar haben nicht alle Handlungen ein natürliches Ziel. Aber wenn eine Handlung ein natürliches Ziel hat, so ist anzunehmen, dass es nicht schwer ist, es zu kennen, und dass jede erwachsene Person unter normalen Umständen weiß, was das natürliche Ziel einer solchen Handlung ist. Es lässt sich danach argumentieren, dass die Handlung, jemanden zu zerstückeln und zu kochen, aufgrund ihrer Natur das Ziel hat, jemanden zu töten. Die Töchter des Pelias befinden sich, wenn sie Medeas Überredung Glauben schenken, in Unwissenheit über das natürliche Ziel ihres Handelns. Das ist psychologisch möglich, aber diese Unwissenheit ist nicht zu entschuldigen, da es ein notwendiges und zudem nicht schwierig zu erwerbendes Wissen ist, den eigentlichen Zweck des Zerstückelns und Kochens zu kennen. Absurd wäre es hingegen, davon auszugehen, dass die Töchter des Pelias das psychologische Ziel ihres Tuns nicht kennen – denn sie zerstückeln und kochen ihren Vater ja tatsächlich mit der Absicht, ihn dadurch zu verjüngen.
Zu (ii): Was ist unter Wissen zu verstehen, das notwendig und/oder einfach zu erwerben ist? Die beiden zuletzt genannten Beispiele geben einen Hinweis, in welche Richtung eine aristotelische Antwort auf diese Frage gehen könnte. Eine eindeutige Antwort wird indes dadurch erschwert, dass Aristoteles wenige bis gar keine Angaben dazu macht, was er unter leicht zu erwerbendem oder notwendigem Wissen versteht. Ein Grund dafür liegt darin, dass er es in den ethischen Schriften vermeidet, allgemeine Regeln bzw. Gebote oder Verbote zu formulieren. Er verweist stattdessen meist auf den Klugen (phronimos), der Maßstab für richtiges Handeln ist und der sich dadurch auszeichnet, dass er in jeder einzelnen Handlungssituation erkennt, welches die richtige Handlung ist. Ein anderer Grund mag sein, dass sich Aristoteles der Schwierigkeit sehr bewusst ist, allgemeine Regeln anzugeben, die ausnahmslos für jeden unter allen denkbaren Umständen und auch in Zukunft Gültigkeit besitzen, und sich daher davor hütet, solche Regeln zu geben. Allerdings deutet er m.E. mit einzelnen seiner Beispiele an, dass er in wenigen Fällen offenbar davon ausgeht, dass es doch auch schlechthin verbotene oder gebotene Handlungen gibt. Diese Gebote oder Verbote nicht zu kennen, ist nicht mit Berufung auf Unwissenheit zu entschuldigen, so dass deren Kenntnis als notwendiges Wissen angesehen werden kann. In der EN III grenzt er von den zu entschuldigenden Formen von Unwissenheit die Unwissenheit des Allgemeinen ab, die keine Entschuldigung verdient, und erwähnt hier den Muttermord, der durch nichts zu rechtfertigen ist, sondern an dessen Stelle der eigene Tod in Kauf zu nehmen ist. Ferner sind auch die Töchter des Pelias für ihr Tun nicht durch ihre Unwissenheit zu entschuldigen, weil sie das natürliche Ziel ihrer Handlung nicht kennen, dessen Kenntnis aber offenbar von jeder erwachsenen Person erwartet wird. Es ist zu vermuten, dass es solche Dinge sind, die Aristoteles als leicht und/oder notwendig zu wissen ansieht, und die nicht zu wissen, keine Entschuldigung verdient, sondern die ebenso wie darauf beruhende Handlungen einer Person als ihr Versäumnis zuzurechnen sind.
Zu (iii): Weshalb haben Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz keinen entschuldigenden Einfluss auf das unwissentliche Tun einer Person? Diesen drei Ursachen, die nach Aristoteles verantwortlich dafür sein können, dass eine Person nicht über leicht zu erwerbendes und/oder notwendiges Wissen verfügt, ist gemeinsam, dass sie in seinen Augen auf ein charakterliches Defizit zurückzuführen sind. Woran eine Person in einer Situation Lust und Schmerz empfindet (oder anders formuliert: das, woran eine Person Gefallen findet, was ihr angenehm ist, sowie das Gegenteil, mithin das, wogegen eine Person eine Abneigung verspürt, was ihr unangenehm ist), beruht nach Aristoteles auf ihrer charakterlichen Beschaffenheit. So reicht es für Tugendhaftigkeit nicht aus, jeweils zu wissen, worin die tugendhafte Handlung besteht und auf die richtige Weise zu handeln; tugendhaft ist eine Person erst, wenn sie auch Lust an ihrem richtigen Handeln verspürt und sie sich nicht nur widerwillig dazu entschließt. So unterscheidet sich der Mäßige vom bloß Beherrschten dadurch, dass der Mäßige nicht nur weiß, wie mäßig zu handeln ist und entsprechend handelt, sondern dass er dies auch gern tut und keine gegenläufigen Begierden verspürt; demgegenüber handelt der Beherrschte zwar genau auf die gleiche Weise wie der Mäßige und er fasst ebenfalls denselben richtigen Entschluss zum Handeln, er verspürt dabei aber widerstrebende Begierden, die er unterdrücken muss, und empfindet daher in gewisser Weise Schmerz bzw. Unwohlsein bei seinem Tun.
Wenn Lust und Schmerz Ursache dafür sind, dass eine Person ein notwendiges oder einfach zu erwerbendes Wissen nicht erworben hat, so lässt sich das so verstehen, dass die Person aufgrund ihres Charakters z.B. unnötigen Aufwand bei der Beschaffung der erforderlichen Information gescheut hat, oder dass eine Person sich Wissen, das notwendig für tugendhaftes Handeln ist, nicht beschafft hat, weil es ihr kein Wohlbefinden bereitet hat, sich darum zu bemühen.
In der Nachlässigkeit (ameleia) einer Person kommt nach Aristoteles zum Ausdruck, dass sie es versäumt hat, durch entsprechende Handlungen Charaktertugenden zu entwickeln. In EN III 7 erörtert er die Frage der Zurechenbarkeit von Charakterdispositionen und hier diskutiert er den möglichen Einwurf, dass sich eine Person für ihr schlechtes Handeln damit entschuldigt, dass sie einfach „so beschaffen ist, dass sie nicht Sorgfalt übt“ (1114a4). Diesen Einwand weist Aristoteles durch Verweis auf seine Auffassung vom Charaktererwerb zurück, wie er sie in EN II entwickelt hat.11 Demnach werden Tugenden und Laster durch das regelmäßige und wiederholte Ausführen entsprechender ähnlicher Handlungen erworben, woraus sich schließlich stabile Charakterdispositionen bilden. Eine Person wird nachlässig, wenn sie wiederholt nachlässig lebt und handelt, bis sich in der Folge ein nachlässiger Charakter verfestigt. Weil die Handlungen, aus denen ein bestimmter Charakter resultiert, willentlich sind, ist nach Aristoteles auch der Charakter willentlich. Daraus ergibt sich, dass auch eine Unwissenheit um Dinge, die notwendig oder/und leicht zu wissen sind, welche auf der Nachlässigkeit einer Person beruht, dieser zuzuschreiben ist, da es bei ihr gelegen hätte, nicht so zu werden, dass sie keine Sorgfalt übt beim Erwerb von derartigem Wissen.
Anwendungsfälle: akratische Handlungen und Fehler
Anhand von zwei anderen Beispielen möchte ich nochmals Aristoteles’ Erläuterung betrachten, wie eine Person über potentielles Wissen verfügt, dieses aber nicht anwendet, wobei ihr dieses Versäumnis anzulasten ist.
(1) Akratische Handlungen: Das erste Beispiel sind akratische Handlungen, also Handlungen wider besseres Wissen, die Aristoteles in Buch VII der EN (Kapitel 1-11) diskutiert. Im fünften Kapitel, das die sog. Wissensaporie zum Inhalt hat, präsentiert er zur Erklärung der Möglichkeit akratischer Handlungen verschiedene Unterscheidungen, wie eine Person wissen kann, was getan werden soll, ohne auch entsprechend zu handeln. An zweiter Stelle unterscheidet er zwischen allgemeinen und partikulären Prämissen und nimmt an, dass der Akratiker zwar die allgemeine Prämisse weiß bzw. versteht, die partikuläre jedoch entweder nicht hat oder nicht gebraucht (EN VII 5, 1147a1-3).12 Die allgemeine Prämisse differenziert er weiter in zwei mögliche Konstituenten, nämlich einerseits die handelnde Person und andererseits den Gegenstand, auf den sich die Handlung bezieht. Die partikuläre Prämisse, die der Akratiker entweder nicht besitzt oder die er nicht gebraucht, kann einen oder beide dieser Konstituenten betreffen, wodurch sich die Möglichkeiten des Fehlgehens mehren. Aristoteles’ Beispiel für eine allgemeine Prämisse, die der Akratiker hat und gebraucht, lautet, dass trockene Nahrung für jeden Menschen (und damit auch für den Akratiker selbst) gesund ist. Die partikuläre Prämisse lautet, dass diese Nahrung, z.B. dieses Brot, trockene Nahrung ist. Akratisches Handeln ist dadurch zu erklären, dass der Akratiker die partikuläre Prämisse entweder gar nicht hat oder dass er zwar die partikuläre Prämisse zwar hat (mit anderen Worten: dass er zwar potentiell weiß, dass dieses Brot hier trockene Nahrung ist), dass er sie aber nicht unter die allgemeine Prämisse subsumiert, d.h., dass er sie nicht insofern in Verbindung mit der allgemeine Prämisse gebraucht, als er sie als Unterfall der allgemeinen Prämisse verwendet.
Wie es zu verstehen ist, dass jemand zwar die allgemeine Prämisse weiß, die partikuläre aber nicht anwendet, obwohl er sie besitzt, lässt sich anhand einer Unterscheidung von zwei Arten von Wissen deuten, die Aristoteles zu Beginn der Zweiten Analytiken einführt:13
[APo I 1, 71a24-29]
„Bevor man dagegen eine Induktion durchgeführt oder eine Deduktion vorgenommen hat, muss man vielleicht sagen, dass man es zwar auf gewisse Weise weiß, auf andere Weise jedoch nicht. Wovon man nämlich nicht wusste, ob es schlechthin ist, wie wusste man davon schlechthin, dass es zwei rechte Winkel hat? Aber es ist klar, dass man es so weiß, dass man es allgemein weiß, schlechthin jedoch nicht weiß. [Übersetzung Detel].“
Aristoteles differenziert hier zwischen den Fällen, etwas allgemein zu wissen und etwas schlechthin bzw. ohne Qualifikation zu wissen, und nimmt in Bezug auf eine Deduktion an, dass man vor ihrer Durchführung zwar allgemein, nicht aber schlechthin weiß, was aus einer Menge von Annahmen folgt. Übertragen auf den Akratiker heißt das, dass er zwar allgemein weiß, was zu tun ist, z.B. dass trockene Nahrung, wie etwa Brot, gesund ist und gegessen werden soll, dass er aber nicht schlechthin weiß, was zu tun ist, weil er nicht weiß, dass die vor ihm liegende Nahrung Brot und somit trockene Nahrung ist. Auf diese Weise ist es nach Aristoteles „keineswegs abwegig“ zu sagen, dass eine Person weiß, dass trockene Nahrung gesund ist und damit in allgemeiner Weise auch weiß, dass dieses Brot vor ihr gesund ist, dass sie aber trotzdem in dieser Situation nicht realisiert, dass dieses Brot gesund ist, weil sie die Prämisse, dass dieses Brot gesund ist, nicht unter die allgemeine Prämisse subsumiert.
Als nächstes führt Aristoteles zur Erklärung akratischer Handlungen noch eine andere Weise ein, wie Menschen Wissen haben können, die ebenfalls instruktiv für die Frage nach der Zurechenbarkeit des potentiellen Wissens des Akratikers ist. Er vergleicht den Zustand, in dem sich der Akratiker befindet, wenn er Wissen hat, aber nicht anwendet, mit dem Zustand von Menschen, die schlafen, rasen oder betrunken sind, sowie mit Personen, die unter dem Einfluss starker Emotionen, wie z.B. Zorn und heftiger sexueller Begierden stehen. Derartige Einflüsse verändern die psychologische oder physiologische Verfassung einer Person so massiv, dass sie Wissen, das sie im Normalzustand eigentlich besitzt und zuverlässig anwenden kann, vorübergehend nicht mehr aktualisieren kann. In einer derartigen Verfassung befindet sich laut Aristoteles auch der (schwache) Akratiker, dessen unvernünftige Begierden derart heftig sind, dass er aufgrund seines psychischen oder physiologischen Zustandes vorübergehend nicht in der Lage ist, sein Wissen um das richtige Tun auf den konkreten Fall anzuwenden. Der Akratiker befindet sich dann in einem Zustand, in dem er „auf gewisse Weise Wissen hat und nicht hat“ (1147a12-13). Unwissend handelt der Akratiker einerseits, weil er aufgrund seines kognitiven Zustandes sein Wissen um das richtige Handeln, über das er eigentlich verfügt, nicht anwendet und sogar in diesem Moment nicht einmal anwenden kann. Andererseits ist der Akratiker wissend, wenn er akratisch handelt, weil er potentiell über Wissen vom richtigen Handeln verfügt, auch wenn er es in dieser Situation aufgrund seines Zustandes nicht anwenden kann. Da es ihm aber anzulasten ist, in diesen Zustand geraten zu sein, der ihn davon abhält, sein Wissen um das Richtige anzuwenden, ist er für sein Handeln zu tadeln, auch wenn es in einer Weise unwissentlich erfolgt.
(2) Fehler: Der zweite Fall, an dem sich veranschaulichen lässt, dass eine Person zwar über potentielles Wissen verfügt, dieses aber nicht anwendet, sind Fehler (hamartia/hamartêma). Aristoteles unterscheidet in EN V 10 im Kontext einer Analyse der Bedingungen, die Handlungen ungerecht machen, zwischen verschiedenen Arten von Schädigungen (blabai). Er nennt zwei Arten von Schädigungen, die unwissentlich geschehen, nämlich Unglücksfälle (atychêmata) und Fehler (hamartêmata). Fehler unterscheiden sich dadurch von Unglücksfällen, dass sie nicht gegen die vernünftige Erwartung (mê paralogôs) geschehen und dass sie ihren Ursprung in der handelnden Person haben. Im Gegensatz zu wissentlich erfolgenden Unrechtstaten geschehen Fehler nicht aus Schlechtigkeit und aufgrund eines entsprechenden Entschlusses (prohairesis). Fehler sind demnach Handlungen, die eine Person zwar unwissentlich begeht, wenngleich ihre Handlung nicht gegen ihre Erwartung erfolgt. Anschauliche Beispiele für Fehler gibt Aristoteles in der Poetik: Den Vatermord, den Ödipus begeht, unwissend um die Identität des Mannes, den er tötet, bezeichnet Aristoteles als „großen Fehler“ (Poet. 13). Ödipus hat seinen Vater nicht aus Schlechtigkeit getötet, sondern weil es für ihn in der konkreten Situation unerwartet war, dass sein Gegenüber sein Vater ist.
Für die Beurteilung der Zurechenbarkeit von Fehlern und der Folgen fehlerhafter Handlungen ist entscheidend, wie es zu verstehen ist, dass Fehler nicht gegen die (vernünftige) Erwartung (der handelnden Person) geschehen. In der Physik sagt Aristoteles, dass sich die vernünftige Überlegung (logos) auf das bezieht, was immer oder meistens der Fall ist. Dagegen ist der Zufall etwas, was der vernünftigen Überlegung entgegensteht (Phys. II 5, 197a18-21).14 Fehler beziehen sich also auf etwas, was zumindest meistens der Fall ist und was prinzipiell rationalisierbar ist, d.h. prinzipiell vernünftiger Überlegung zugänglich ist. Fehler sind nicht unerklärlich, weil sie nicht unerwartet geschehen; es ist grundsätzlich möglich ist, für ihr Zustandekommen eine rationale und kohärente Erklärung zu geben. Dass ein Fehler grundsätzlich rational erklärlich ist und daher nicht unerwartet geschieht, ist jedoch davon klar zu unterscheiden, dass die handelnde Person faktisch erwartet, dass sie einen Fehler begeht. Für die Unterscheidung der verschiedenen Schädigungsarten in EN V 10 ist es vielmehr wesentlich, dass im Fall von Fehlern die handelnde Person zum Zeitpunkt ihrer Handlung faktisch die genauen Einzelumstände ihrer Handlung nicht kennt und deswegen gegen ihr eigenes Erwarten einen Fehler begeht, wenngleich das Zustandekommen des Fehlers (auch für die handelnde Person) grundsätzlich erklärbar ist und nicht der vernünftigen Erwartung zuwiderläuft. Verfügte die Person allerdings zum Zeitpunkt ihrer fehlerhaften Handlung über eine vernünftige Erklärung für ihr Handeln und könnte mit der Schädigung rechnen, so handelte es sich bei ihrer Handlung nicht mehr um einen Fehler, sondern um eine Unrechtstat (adikêma).
Die Charakterisierung von Fehlern als etwas, was mê paralogôs geschieht, lässt unterschiedliche Deutungen hinsichtlich der Zurechenbarkeit von Fehlern zu. Entscheidend für die Frage, ob und ggf. inwieweit Fehler der handelnden Person zurechenbar sind, scheint zu sein, welche Art von Erwartbarkeit dem Zustandekommen von Fehlern zugrunde liegt. Hierzu lassen sich zwei Auffassungen unterscheiden: Einige Autoren, v.a. deutsche Rechtswissenschaftler zu Beginn des 20. Jahrhunderts, haben die Auffassung vertreten, dass Aristoteles’ Unterscheidung verschiedener Schädigungsarten in EN V 10 eine Vorstufe der im Römischen Recht etablierten Trias von Casus, Culpa und Dolus ist und dass Fehler das Konzept des fahrlässigen Vergehens (Culpa) vorbereiten.15 Diese Deutung fußt darauf, dass Fehler hiernach als Handlungen beschrieben werden, deren Resultat die handelnde Person hätte voraussehen und erwarten können, weil Fehler grundsätzlich rationalisierbar sind; es ist deswegen der handelnden Person anzulasten, nicht darüber Bescheid zu wissen, welcher Art ihr Handeln ist und welche Folgen es erwartungsgemäß haben wird, weil ihr diese Informationen zugänglich gewesen sind. Es fällt auf, dass sich diese Erklärung der Tadelnswürdigkeit von Fehlern mit der Beschreibung von unwissentlichem, aber zurechenbarem Handeln aus EE II 9 deckt: auch hier mangelte es der handelnden Person an einfach zu erwerbendem Wissen, das sie sich aufgrund von Nachlässigkeit nicht verschafft hat. So verweisen Vertreter dieser Ansicht auch zur Begründung ihrer Ansicht auf Aristoteles’ Beschreibung selbst-verschuldeter Arten von Unwissenheit in EN III 7 und fassen Fehler als eine Unterart von Handlungen aufgrund von Nachlässigkeit (ameleia) auf.
Eine alternative Deutung von Fehlern versucht diese dagegen deutlicher von jenen unwissentlichen Handlungen, bei denen Nachlässigkeit die Ursache für die Unwissenheit ist, abzugrenzen. Dies ist beispielsweise dadurch möglich, dass die rationale Erwartbarkeit des Zustandekommens von Fehlern nicht normativ, sondern faktisch verstanden wird. Dass ein Fehler nicht unerwartet eintritt, besagt somit erst einmal nur soviel, als dass es eine rationale Erklärung für dessen Auftreten gibt. Es wird damit aber noch keine Aussage darüber gemacht, ob die handelnde Person hätte voraussehen und erwarten sollen, dass ihr Tun zu diesem Fehler führt. Es wird damit also nicht gesagt, dass Fehler auf ein Versäumnis der handelnden Person, z.B. ein charakterliches Defizit wie ein nachlässiger Charakter, zurückzuführen sind.
Wenn man sich ansieht, wie Aristoteles in EN V 10 die unterschiedlichen Arten von Schädigungen charakterisiert, deutet dies m.E. stark darauf hin, dass Fehler von anderen unwissentlichen schlechten Handlungen, die nicht entschuldbar sind, wie denjenigen einer nachlässigen Person oder des Akratikers, abzugrenzen sind. Fehler sind diesen Fällen gegenüber weniger schlimme Schädigungen; sie verdienen keinen (oder allenfalls nur eine sehr moderate Form von) Tadel, da sie zwar grundsätzlich rationalisierbar sind, es aber nicht auf einem charakterlichen Defizit der handelnden Person beruht, dass diese deren Zustandekommen in der konkreten Situation faktisch nicht erwartet hat. Diese klare Distinktion zwischen Fehlern und Unbeherrschtheit (akrasia) wird außerdem durch eine Aussage in EN VII 6 gestützt, wo Aristoteles die Unbeherrschtheit überhaupt einerseits vom Laster der Unmäßigkeit (akolasia) als weniger schlechte Charakterform abgrenzt, sie andererseits aber zumindest als „eine Art von Laster (kakia tis)“ und „nicht nur als Fehler (ouch hôs hamartia monon)“ bezeichnet.16
Ausblick: Anschlussfähigkeit an aktuelle Ansätze und Diskussionen
Abschließend will ich vier Punkte skizzieren, an welchen Stellen und in welcher Weise sich die aristotelische Auffassung der Zurechenbarkeit von potentiellem und nicht-potentiellem Wissen als anschlussfähig für aktuelle Diskussionen erweisen könnte bzw. diese sich für eine weitere Analyse der aristotelischen Position fruchtbar machen lassen könnten. Die ersten beiden Punkte betreffen aktuelle Ansätze, mit denen sich Aristoteles’ Unterscheidungen m.E. weiterführend diskutieren lassen (i und ii); die beiden anderen Punkte umreißen thesenartig Beispiele, die die aristotelische Konzeption der Zurechenbarkeit von Wissen mit unserer heutigen Lebenswelt konfrontieren (iii und iv).
(i) Das Wissenserfordernis bei zurechenbarem Handeln: Es ist wünschenswert, mehr über das Wissen bzw. die Wissensinhalte und die praktischen Gründe (d.h. die entsprechenden epistemischen Normen) zu sagen, von denen anzunehmen ist, dass jede vernünftige Person darüber verfügen soll, so dass Mangel an derartigem Wissen der Person als ihr Verschulden zuzurechnen ist. Es ist zu prüfen, ob und inwieweit probabilistische Theorien des Wissens hier plausible Erklärungsansätze bieten. Sarah Moss vertritt eine Theorie des Wissens, nach der auch probabilistische Inhalte ausreichend für Wissen sein können.17 Danach kann einer Person auch dann Wissen zugesprochen werden, wenn sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Überzeugung ist, dass etwas der Fall ist. Moss wendet diesen Ansatz auf verschiedene Beispielfälle an: So deutet sie die in Ländern des common law vor Gericht übliche Anforderung, dass ein „Beweis jenseits eines begründeten Zweifels“ (proof beyond a reasonable doubt) ist, derart, dass ein Richter oder ein Gericht über ein bestimmtes probabilistisches Wissen verfügen muss. Sie argumentiert ferner, Diskriminierungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, wie z.B. aufgrund des Geschlechts, einer Ethnie, einer sozialen Klasse etc. (racial profiling) auch als epistemische Fehler (und nicht nur moralische Fehler) anzusehen. Der epistemische Fehler besteht darin, dass eine derartige Diskriminierung auf einer unzureichenden Anwendung statistischer Daten beruht und es versäumt wird, die Möglichkeit von Ausnahmen bei der Bildung einer Überzeugung zu berücksichtigen. Eine Theorie, die von probabilistischem Wissen ausgeht und für ein Wissenserfordernis plädiert, das mehr als statistische Belege verlangt, erscheint mir geeignet, die aristotelischen Wissenserfordernisse näher zu interpretieren.
(ii) Ein anderer Ansatz, das Wissenserfordernis für zurechenbares Handeln zu deuten, besteht in der Verbindung dieser Frage mit der Ethics for Belief-Debatte.18 Dabei geht es um die Frage nach den grundlegenden Normen, die die Bildung von Überzeugungen steuern. Insbesondere bei zukunftsbezogenen Überzeugungen (wie z.B. Versprechen und Vorsätzen), die Handlungen in der Zukunft zugrunde liegen und regulieren, stellt sich die Frage, ob sie aufgrund von Evidenzen (z.B. Statistiken) oder aufgrund von praktischen Gründen, die unter Umständen den Evidenzen widersprechen, gebildet werden.19 Da derartiges praktisches Wissen Wissen ist, das für die Zurechenbarkeit von aktualem oder potentiellem Wissen bedeutsam ist, könnten sich aktuelle Debatten zu praktischem Wissen für eine Deutung der aristotelischen Konzeption fruchtbar machen lassen.
(iii) Zurechnung neuer Risiken und Risikofolgenabschätzung: Eine andere Dimension erhält die Frage nach der Zurechenbarkeit von Wissen sowie der darauf beruhenden Handlungen und Handlungsfolgen heute infolge der immensen Fortschritte in den Naturwissenschaften und in der Technik. Anders als im antiken Athen verfügt die Menschheit heute über die Fähigkeit, sich selbst und die bewohnbare Erde zu zerstören (Kernenergie-Risiken). In der Soziologie hat Niklas Luhmann die Bedeutung des Risikos, das in der Zukunft durch Entscheidungen in der Gegenwart entsteht, schon vor fast 30 Jahren identifiziert und analysiert.20 Die Anzahl interdisziplinärer Studien zur Operationalisierung von Zurechenbarkeit in unterschiedlichen Gebieten wie z.B. im Technik- oder Umweltrecht (z.B. im Bereich der Künstlichen Intelligenz oder der Klimaforschung) und in der medizinischen Forschung (z.B. in der Pränataldiagnostik und Reproduktionsmedizin), hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Hier ist zu prüfen, ob und inwieweit die aristotelischen Kategorien des potentiellen und des notwendigen und/oder einfach zu erwerbenden Wissens zum Zwecke der Urteilsbildung und Entscheidungsfindung herangezogen werden können.21
(iv) Kontextabhängigkeiten der Zurechenbarkeit von Wissen: Aristoteles entwickelt seine Ansicht von der Zurechenbarkeit von Wissen vor dem Hintergrund der homogenen und ökonomisch stabilen Gesellschaft einer antiken Polis, d.h. eines überschaubaren Kleinstaats mit einer einheitlichen Bevölkerungsstruktur. In unserer Zeit erscheint somit gerade Aristoteles’ Desiderat von notwendigem oder leichtem Wissen, über das jeder (Polisbürger?) verfügen muss, als große Herausforderung: So stellt sich infolge von Migrationsbewegungen die Frage, inwieweit Herkunft und kulturelle Hintergründe Einfluss darauf haben, welches Wissen in einer multiethnischen und multireligiösen Gesellschaft als solches zu gelten hat, dessen Besitz und Gebrauch von jedem erwartet werden kann. Wie weit reicht die „rationale Erwartbarkeit“ bezüglich von Gesetzen, Konventionen und Urteilsvermögen, über die jeder Staatsbürger*in und jeder Mitbürger*in zu verfügen hat, mit anderen Worten: deren Mangel jedermann als Versäumnis zuzurechnen ist?
Obwohl bei Aristoteles keine Antworten auf solche Fragen unserer Zeit zu finden sind, so lässt sich seine Konzeption trotzdem als ernstzunehmender Referenzpunkt ansehen, der auch für aktuelle Diskussionen einen originellen Beitrag leistet.