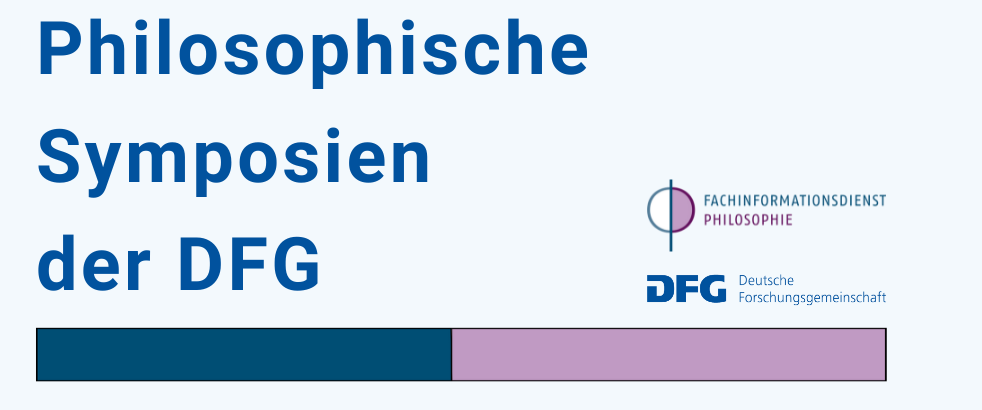Fähigkeiten und Dispositionen
Beitrag zum Philosophischen Symposium 2019 der Deutschen Foschungsgemeinschaft (DFG)
Fähigkeiten und Dispositionen
Dinge haben Eigenschaften. Einige dieser Eigenschaften sind sogenannte modale Eigenschaften. Unter modalen Eigenschaften verstehe ich Eigenschaften, deren Wahrheitsbedingungen sich nur unter Rückgriff auf bloß mögliche Umstände ausbuchstabieren lassen. Am Beispiel: Um zu einem bestimmten Zeitpunkt zerbrechlich zu sein, muss ein Ding nicht tatsächlich zu diesem Zeitpunkt zerbrechen. Vielleicht zerbricht es sogar nie, weil jemand, dem an dem Ding gelegen ist, es in einem unzerstörbaren, versiegelten Behälter eingeschlossen hat. Zerbrechlich bleibt das Ding dennoch. Das hat damit zu tun, dass es möglich ist, dass das Ding zerbricht, und dass das Ding unter bestimmten Umständen zerbrechen würde. Wir befinden uns im Bereich des Modalen.
Mindestens einige modale Eigenschaften von Dingen sind sogenannte „Potentialitäten“. Ob es alle oder bloß einige sind, ist eine terminologische Frage. Man kann „Potentialität“ als anderes Wort für „modale Eigenschaft“ verstehen. Man kann Potentialitäten aber auch als Eigenschaften verstehen, die instantiiert sein können, ohne manifestiert zu sein. Auf Zerbrechlichkeit passt das gut. Zerbrechlichkeit wäre der vorgeschlagenen Definition nach eine Potentialität. Auf die Eigenschaft der notwendigen Existenz - beispielsweise eines Gottes - passt es nicht. Diese Eigenschaft ist zwar klarerweise modal, aber keine Potentialität im definierten Sinne.
Ich werde Potentialitäten im zweiten, anspruchsvolleren Sinn verstehen, denn mich werden genau solche Eigenschaften beschäftigen, die instantiiert sein können, ohne manifestiert zu sein. Bisher habe ich über die Potentialität der Zerbrechlichkeit gesprochen. Zerbrechlichkeit ist eine Disposition. Andere Dispositionen sind Brennbarkeit, Elastizität und Löslichkeit, aber auch Jähzorn, Empfindlichkeit oder Schüchternheit. All diese Dinge haben damit zu tun, was mit einem Objekt oder einer Person in bestimmten Situationen - und zwar nicht nur den tatsächlichen, sondern auch bloß möglichen Situationen - geschehen würde.
Eine andere Art von Potentialitäten sind Fähigkeiten. Anke kann stricken, Brigitte kann Kampfjets fliegen, Carsten und Dirk können gemeinsam Walzer tanzen. Wie im Fall von Dispositionen fällt Instantiierung und Manifestation auseinander. Eine Fähigkeit kann man auch dann haben, wenn man sie gerade nicht ausübt. Aber wie im Fall von Dispositionen haben Fähigkeiten damit zu tun, was mit der Akteurin unter bestimmten möglichen (einschließlich der tatsächlichen) Situationen geschehen würde.
Die Beispiele für Dispositionen und Fähigkeiten habe ich so gewählt, dass ihre Unterschiedlichkeit möglichst deutlich zum Vorschein tritt. Dispositionen, so die grundlegende Intuition, sind passiv. Auf den disponierten Gegenstand wirkt ein Reiz von außen ein und in Reaktion darauf geschieht mit dem Gegenstand etwas: der Gegenstand zerbricht, dehnt sich aus, löst oder regt sich auf, fühlt sich getroffen. Fähigkeiten hingegen, so scheint es, sind aktiv. Die Akteurin setzt einen Impuls - sie fasst einen Entschluss, bildet einen Willen aus - und setzt so eine Handlung in Gang. Sie strickt, tanzt oder fliegt los.
Bei näherem Hinsehen gerät dieses Bild in Wanken. Ob es sich in einem bestimmten Fall um eine Fähigkeit oder eine Disposition handelt, ist weniger offensichtlich, als es zunächst scheinen mag. Wie sieht es beispielsweise mit Trinkfestigkeit aus? Ist das eine Disposition oder eine Fähigkeit? Was ist mit einem guten Erinnerungsvermögen? Was mit einem einnehmenden Lachen oder damit, unfreiwillig komisch zu sein? Was ist mit Sehen, Hören, Riechen? Was ist mit Rationalität? Sind das Dispositionen oder Fähigkeiten?
Die Antwort ist: Sowohl als auch. Wie ich zeigen werde, ist der Unterschied zwischen Fähigkeiten und Dispositionen weniger trennscharf, als gemeinhin angenommen wird. Fähigkeiten, so werde ich argumentieren, sind Dispositionen; und zwar Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten.
Diese Theorie - die teleologische Fähigkeitstheorie, wie ich sie nennen möchte, - werde ich in den folgenden Sektionen Schritt für Schritt entwickeln. In der ersten Sektion gebe ich eine kurze Einführung in die zeitgenössische Dispositionendebatte. In der zweiten Sektion entwickle ich eine Fähigkeitstheorie für Handlungsfähigkeiten, also für Fähigkeiten, intentionale Handlungen auszuführen. In der dritten Sektion nehme ich Nicht-Handlungsfähigkeiten in den Blick und zeige, dass sich die intuitiven Unterscheidungskriterien für Dispositionen und Fähigkeiten im Falle von Nicht-Handlungsfähigkeiten als nicht besonders tragfähig erweisen. In der vierten Sektion präsentiere ich die teleologische Fähigkeitstheorie, derzufolge Fähigkeiten Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten sind. In der fünften Sektion behandle ich den Fall, in dem die Zweckmäßigkeit einer Disposition ausschließlich durch die Zwecke einer Zuschreiberin gegeben ist. Ich ende in Sektion sechs mit einem Fazit.
1. Dispositionen
Lange dachte man, ein Ding sei zerbrechlich, wenn es bei einem Stoß zerbrechen würde. Eine Aussage der Form „Das Objekt O hat die Disposition, M zu tun“ hielt man für eine Ellipse für „Das Objekt O hat die Disposition, in Reaktion auf Stimulus S M zu tun“. Und diese Aussage wiederum, dachte man, werde am besten unter Rückgriff auf ein kontrafaktisches Konditional ausbuchstabiert. Eine Disposition zu haben, heißt demnach: Würde der Stimulus vorliegen, dann würde sich die Manifestation zeigen. In der Debatte ist diese Theorie als „einfache konditionale Analyse“ bekannt. Die Analyse wurde beispielsweise von Ryle (1949), Goodman (1954) und Quine (1960) vertreten.1
Bei Zerbrechlichkeit sieht die einfache konditionale Analyse zunächst recht plausibel aus. Bei vielen anderen Dispositionen hingegen stößt sie schnell an ihre Grenzen. Einige Dispositionen haben nämlich gar keine klar bestimmbaren Stimuli. Dass eine Person eine Quasselstrippe ist, erkennt man zum Beispiel daran, dass sie in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Situationen quasselt.2 Einen besonderen Stimulus braucht sie dafür gerade nicht. Es ist also in vielen Fällen gar nicht so klar, was man in das Vorderglied des kontrafaktischen Konditionals schreiben sollte.
Ein anderes Problem der einfachen konditionalen Analyse ist, dass Dispositionen in aller Regel maskierbar sind.3 Damit ist gemeint, dass es fast immer möglich ist, dass zwar der Stimulus auftritt, aber die Manifestation dennoch ausbleibt. Einfacher ausgedrückt: Es kann so gut wie immer etwas dazwischen kommen. Etwas kann giftig sein und dennoch muss es nicht wahr sein, dass ich Vergiftungserscheinungen bekäme, würde ich es einnehmen. Vielleicht würde ich auch einfach ins Krankenhaus fahren und mir den Magen auspumpen lassen. In solchen Fällen ist das kontrafaktische Konditional schlichtweg falsch.
Ein drittes Problem: Dispositionen sind graduierbar.4 Ein Champagnerglas ist zerbrechlicher als ein Wasserglas. Aber wenn beide auf der Tischkante stehen und darunter ein Betonboden auf sie wartet, würden beide bei einem Stoß zerbrechen. Ein einzelnes kontrafaktisches Konditional ist daher offenbar nicht imstande, Grade von Fähigkeiten einzufangen.
Aus diesen und anderen Gründen ist die einfache konditionale Analyse heute weitestgehend vom Tisch. Stattdessen ist die allgemeine Auffassung: Man muss die Komplexität der Analyse erhöhen. Eine Art, das zu tun, haben prominent Manley und Wasserman5 vorgeschlagen. Ihre Idee ist: Wenn ein kontrafaktisches Konditional nicht reicht, dann braucht man eben sehr viele. Manley und Wasserman’s Analyse zufolge ist etwas zum Beispiel genau dann zerbrechlich, wenn es in einer hinreichenden Proportionen von möglichen Situationen, in denen es einen Stoß erfährt, zerbrechen würde. Allgemein gesprochen:
M&W. Ein Objekt hat genau dann die Disposition, M zu tun, wenn es in einer hinreichenden Proportion möglicher Situationen, in denen ein Stimulus vorliegt, M tun würde.
Im Unterschied zur einfachen konditionalen Analyse sagt M&W also: Damit ein Ding eine Disposition hat, muss das einfache kontrafaktische Konditional „Wenn der Stimulus auftreten würde, würde die Manifestation auftreten“ in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen wahr sein.6
Die Proportionen sorgen dafür, dass Grade eingefangen werden können. Klar: Wenn das Champagnerglas und das Wasserglas auf der Tischkante über dem Beton stehen, dann würden beide zerbrechen, wenn sie einen Stoß erfahren würden. Aber in Situationen, in denen ein dünner Teppich unter dem Tisch liegt, würde nur das Champagnerglas, nicht aber das Wasserglas zerbrechen. Insgesamt ist die Proportion der möglichen Situationen, in denen das Champagnerglas bei einem Stoß zerbrechen würde, also höher.
Die Proportionen lösen außerdem das Maskierungsproblem. In vielen Situationen, in denen ich Gift im Körper habe, würde ich keine Vergiftungserscheinungen bekommen. Aber in vielen Situationen eben schon. Wenn ich zu weit vom Krankenhaus entfernt bin. Wenn ich nicht gemerkt habe, dass ich etwas Giftiges gegessen habe. Wenn ich lebensmüde bin.
Was durch M&W nicht ohne Weiteres gelöst wird, ist die Sache mit den fehlenden Stimulusbedingungen. Quasselstrippen quasseln ohne besonderen Anlass. Kreative haben in allen möglichen Situationen gute Einfälle. Pessimisten erwarten stets das Schlechteste.
Nicht nur, aber unter Anderem deshalb besteht ein anderer Vorschlag darin, die Komplexität der Analyse wieder ein wenig zu verringern. Weg mit dem Stimulus. Zerbrechlich zu sein, so prominent Barbara Vetter7, heißt einfach, in hinreichend vielen der möglichen Situationen zu zerbrechen. Damit haben wir nun keine konditionale Analyse mehr, sondern eine Analyse, die über die möglichen Situationen insgesamt quantifiziert. Wieder allgemeiner gesprochen, sagt die Analyse:
(BV) Ein Objekt hat genau dann die Disposition, M zu tun, wenn es in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen M tut.
Ob M&W oder BV die überzeugendere Analyse von Dispositionen bietet, müssen wir an dieser Stelle nicht entscheiden. Wichtig ist für den Moment nur, dass Dispositionen offenbar etwas damit zu tun haben, wie sich ein Objekt über mögliche Situationen hinweg verhält. Im Fall von M&W schränken wir die möglichen Situationen zunächst auf diejenigen ein, in denen ein passender Stimulus vorliegt, im Fall von BV schauen wir uns an, wie sich das Objekt in den möglichen Situationen insgesamt verhält. Einig sind sich beide Analysen darin, dass für Dispositionen entscheidend ist, dass in einer hinreichenden Proportion von Situationen, die überhaupt in Betracht gezogen werden, die Manifestation auftreten muss, damit ein Objekt eine Disposition hat.
Wann ist eine Proportion hinreichend? Das lässt sich so allgemein nicht beantworten. Aber das ist auch genau richtig so. Denn Dispositionszuschreibungen sind hochgradig kontextsensitiv. Dazu zwei Beispiele.
Eine Bauarbeiterin sagt zum Kranfahrer: „Vorsicht mit den Marmorplatten, die sind zerbrechlich.“
Jemand sagt zum Vater eines Kindes: „Lass sie ruhig mit dem alten Nokia-Handy spielen. Das ist ja nicht zerbrechlich.“
Wäre „zerbrechlich“ nicht kontextsensitiv, würden uns diese beiden Äußerungen vor ein Rätsel stellen. Wenn Marmorplatten schlechthin zerbrechlich wären, das alte Nokia-Handy aber nicht, dann müssten Marmorplatten zerbrechlicher sein als alte Nokia-Handys. Nokia hätte damals mit dem Slogan „Nokia - robuster als Marmor“ werben können, und es wäre im wörtlichen Sinne wahr gewesen. Absurd.
Nein, in Wirklichkeit greift „zerbrechlich“ im Kontext des Gesprächs auf der Baustelle einfach eine andere Eigenschaft heraus als im Kontext des Gesprächs über das Handy. „X ist zerbrechlich“ hat unterschiedliche Wahrheitsbedingungen, abhängig davon, wie zerbrechlich etwas sein muss, um in einem Kontext als zerbrechlich simpliciter zu gelten. Genau diese Anforderung an eine gute Theorie von Dispositionen fangen M&W und BV mit der Rede von Proportionen ein. Ein Gegenstand muss in einer hinreichenden Proportion aller möglichen (Stimulus-)Situationen zerbrechen, damit man es „zerbrechlich“ nennen kann. Welche Proportion hinreichend ist, legt der Äußerungskontext fest.
2. Fähigkeiten
Fähigkeiten haben eine ganze Reihe von Gemeinsamkeiten mit Dispositionen. Die Fähigkeit, einen Kampfjet zu fliegen, die Fähigkeit, Tontauben zu schießen oder die Fähigkeit, Chopins Prelude in h-moll zu spielen - all diese Fähigkeiten sind modale Eigenschaften, die - wie Dispositionen - gelegentlich maskiert sind, in unterschiedlichen Graden vorliegen können, und deren Zuschreibungen eine entsprechende Kontextsensitivität aufweisen.8
Grade von Fähigkeiten sind uns gut vertraut. Wir üben Dinge, um besser in ihnen zu werden, wir bewundern Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten in einem Bereich, wir sagen Dinge wie „Er spielt besser Klavier, aber sie ist besser im Tontaubenschießen“. Dabei spielen zwei Dimensionen eine Rolle, entlang derer wir Fähigkeiten graduieren. Beim Klavierspielen kommt es in aller Regel vor allem darauf an, möglichst gut zu spielen. Besser ist in der Regel nicht, wer es möglichst verlässlich schafft, überhaupt zu spielen, sondern, wer besser spielt. Wir können sagen, dass wir die Fähigkeit, Klavier zu spielen, in aller Regel auf der „Leistungsdimension“ graduieren. Beim Tontaubenschießen ist das anders. Die Kunst besteht im Schießen der Tontauben als solches. Besser ist daher einfach die Person, die unter mehr Umständen trifft. Wir können sagen, dass wir die Fähigkeit, Tontauben zu schießen, in aller Regel entlang der „Verlässlichkeits-dimension“ graduieren.
Klavierspielen und Tontaubenschießen sind insofern speziell, als in diesen Beispielen eine der beiden Dimensionen in der Regel besonders dominant ist. (Es lassen sich aber auch andere Kontexte konstruieren.) Im Falle der meisten Fähigkeiten müssen wir die Leistungs- und die Verlässlichkeitsdimension aber miteinander verrechnen. Wer baut besser Kartenhäuser? Derjenige, der fast immer vierstöckige Häuser schafft, aber nie höhere, oder diejenige, der zwar selten eine zweite Ebene, aber zwischendurch immer mal ein achtstöckiges Meisterstück gelingt? Schwer zu sagen. Hängt davon ab, worauf es uns ankommt. Auf den Kontext also.
Wie hoch muss der Grad einer Fähigkeit sein, damit wir bereit sind, eine Fähigkeit simpliciter zuzuschreiben? Das ist ebenfalls kontextabhängig. Ein Beispiel macht das klar.
Schießübung
In der Ausbildung müssen Soldat:innen außerordentlich schwierige Schießübungen absolvieren. In den ersten Wochen trifft kaum jemand jemals ins Schwarze. Claudia ist ein Ausnahmetalent. Sie trifft in den ersten drei Wochen unentwegten Trainings tatsächlich zweimal ins Schwarze.
Kontext 1: Claudias Kamerad ist voll des Staunens. „Wahnsinn, die Claudia. Die kann jetzt schon ins Schwarze treffen.“
Kontext 2: Claudias Ausbilderin ist nicht der Meinung, dass Claudia schon in einen Auslandseinsatz geschickt werden sollte. „Sie ist gut, aber sie kann noch nicht ins Schwarze treffen.“
Sowohl die Äußerung des Kameraden als auch die Äußerung der Ausbilderin sind unproblematisch und treffen eine wahre Aussage. Der Grund ist, dass im ersten Kontext ein geringerer Grad der Fähigkeit, ins Schwarze zu treffen, ausreicht, als im zweiten Kontext. In diesem Punkt funktionieren Fähigkeitszuschreibungen offenbar genau wie Zuschreibungen von Dispositionen.
Auch Maskierungen können auftreten. Eine Kampfjetpilotin verliert ihre Fähigkeit, Kampfjets zu fliegen, nicht allein dadurch, dass sie betrunken ist. Ihre Fähigkeit ist lediglich maskiert. Wer die Fähigkeit hat, Tontauben zu schießen, der behält sie auch dann noch, wenn er sich den Finger gebrochen hat, mit dem er normalerweise den Abzug betätigt. Wer fehlerfrei Chopins Prelude in h-moll spielen kann, der kann das auch dann noch, wenn gerade kein Klavier in der Nähe ist. Fähigkeiten können maskiert sein. Etwas kann die erfolgreiche Ausübung der Fähigkeit verhindern. Auch hier verhalten sich Fähigkeiten offenbar wie Dispositionen.
Es gibt allerdings einen wichtigen Punkt zu beachten. Bei Fähigkeiten unterscheiden wir in der Regel zwischen der generellen und der speziellen Fähigkeit, eine Handlung auszuführen (Jaster forthcoming, Jaster & Beckermann 2018). Von einer „generellen Fähigkeit“ spricht man, wenn man sich dafür interessiert, was eine Akteurin grundsätzlich tun kann, unabhängig von ihrer konkreten Situation. Von einer „speziellen Fähigkeit“ spricht man, wenn man sich dafür interessiert, was eine Akteurin in einer ganz konkreten Situation tun kann. In den Beispielen im letzten Absatz habe ich „Fähigkeit“ im generellen Sinn verwendet. Es ist die generelle Fähigkeit, einen Kampfjet zu fliegen, die die betrunkene Kampfjetpilotin behält. Die spezielle Fähigkeit hingegen - die Fähigkeit, den Kampfjet in ihrer konkreten Situation zu fliegen - geht ihr durch die Betrunkenheit verloren. Der Schütze mit dem gebrochenen Finger kann zwar im generellen Sinne immer noch Tontauben schießen, aber nicht im speziellen: hier und jetzt kann er es nicht.
Man könnte meinen, wir hätten hier einen Unterschied zwischen Dispositionen und Fähigkeiten zutage gefördert. Bei näherem Hinsehen lässt sich im Fall von Dispositionen aber ein ganz ähnliches Phänomen feststellen. Der Hund, der die Disposition hat, Besucher anzuspringen, behält diese Disposition auch dann, wenn er gebrochene Hinterläufe hat. Jedenfalls in einem Sinne. Denn natürlich können wir uns auch fragen, welche Disposition der Hund-einschließlich-seiner-gebrochenen-Hinterläufe hat. Und als solcher hat er nicht die Disposition, Besucher anzuspringen. Ein und derselbe Hund kann demnach offenbar unterschiedliche Dispositionen haben, abhängig davon, welche seiner Eigenschaften wir zu einem Paket zusammenschnüren. Wenn wir wissen wollen, welche Dispositionen der Hund grundsätzlich hat, schnüren wir das Paket anders, als wenn wir wissen wollen, welche Dispositionen er in einer ganz konkreten Situation hat. Analog zum Fähigkeitsfall könnten wir von einer „generellen“ und einer „speziellen“ Disposition sprechen. Wir haben hier also keinen echten Unterschied zwischen Fähigkeiten und Dispositionen entdeckt
Angesichts der augenfälligen Ähnlichkeiten zwischen Fähigkeiten und Dispositionen wäre es sehr überraschend, wenn eine Analyse von Fähigkeiten vollkommen anders aussehen würde als die Analysen, die für Dispositionen auf dem Markt sind. Nicht ohne Grund behaupten sogenannte „Neue Dispositionalisten“9, (Fähigkeiten seien gar nichts Anderes, als eine bestimmte Art von Dispositionen. Und nicht ohne Grund sahen die ersten Fähigkeitsanalysen der einfachen konditionalen Analyse von Dispositionen sehr ähnlich. Die Fähigkeiten zu haben, ein Prelude zu spielen, so dachte man lange, heißt schlicht und einfach, dass man das Prelude spielen würde, wenn man es intendieren würde. Was bei Dispositionen der externe Stimulus ist, das ist bei Fähigkeiten die Willensbildung der Akteurin. Damit wäre dann auch erklärt, wieso uns Dispositionen passiv, Fähigkeiten aber aktiv vorkommen.
Sowohl an der Behauptung, Fähigkeiten seien eine bestimmte Art von Dispositionen, als auch an der Idee, dass bei Fähigkeiten die Willensbildung der Akteurin die analoge Rolle zum Stimulus einer Disposition spielt, ist etwas dran. Aber natürlich kommen wir mit der einfachen konditionalen Analyse auch bei Fähigkeiten nicht weiter. Grade, Maskierungen und Kontextsensitivität stellen die Analyse vor dieselben Probleme wie im Fall von Dispositionen. Vielmehr wird eine Fähigkeitsanalyse naheliegenderweise analog laufen zu den Analysen für Dispositionen aus der letzten Sektion.
2.1 M&W:A
Wie eine Analyse für Fähigkeiten aussieht, die analog zu Manley und Wassermans Dispositionenanalyse gestrickt ist, liegt auf der Hand:
M&W:A Eine Akteurin hat genau dann die Fähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion möglicher Situationen, in denen sie ϕ zu tun intendiert, ϕ tun würde.
Hier tritt die Intention der Akteurin an die Stelle, an der im Dispositionenfall der Stimulus auftaucht. Maskierungen, Grade von Fähigkeiten und die damit verbundene Kontextsensitivität werden genau analog zum Dispositionsfall eingefangen.
Einen wichtigen Punkt müssen wir allerdings nachliefern. Aus der Unterscheidung zwischen generellen und speziellen Fähigkeiten lernen wir etwas Entscheidendes über die möglichen Situationen, in denen wir das Verhalten der Akteurin auswerten: Es sind nicht immer alle möglichen Situationen relevant. Wenn wir wissen wollen, was ein Schütze mit gebrochenem Finger angesichts seines allgemeinen Trainingsstandes im Tontaubenschießen tun kann, dann sind auch solche Situationen relevant, in denen der Finger des Schützen nicht gebrochen ist. Im Falle genereller Fähigkeiten variieren wir also eine ganze Reihe der tatsächlichen Merkmale der Situation über die möglichen Situationen hinweg. Wenn wir uns dafür interessieren, was der Schütze angesichts seines gebrochenen Fingers tun kann, dann sind nur solche Situationen relevant, in denen der Finger des Schützen gebrochen ist. Wir halten also einen Großteil der Merkmale der tatsächlichen Situation über die möglichen Situationen hinweg fest.
Hier zeigt sich eine zweite Dimension, auf der Fähigkeitszuschreibungen kontextsensitiv sind. Abhängig davon, welche Merkmale wir festhalten und welche wir variieren, hat ein Satz der Form „S kann PHI tun“ unterschiedliche Wahrheitsbedingungen.
Das ist aber, wie gesagt, im Fall von Dispositionen nicht anders. Auch hier müssen wir uns überlegen, welche Disposition uns interessiert. Die Disposition des Hundes-mit-gebrochenen-Hinterläufen oder die Disposition des Hundes-abzüglich-des-Bruchs-der-Hinterläufe. Entsprechend werden wir auch im Dispositionsfall unterschiedliche Merkmale der tatsächlichen Situation des Hundes über die möglichen Situationen hinweg festhalten und andere variieren, je nachdem, welche Disposition uns in einem Zuschreibungskontext interessiert.
2.2 BV:A
Schwieriger wird es, wenn man versucht, die Analyse von Fähigkeiten analog zu Vetters Dispositionsanalyse zu bauen. Analog zum Stimulus würde man die Intention in einer von Vetter inspirierten Fähigkeitsanalyse einfach weglassen:
BV:A Eine Akteurin hat genau dann die Fähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen ϕ tut.
Damit bekommt man aber umgehend Probleme. Klar, denn die Fähigkeit, ϕ zu tun, und die Disposition, ϕ zu tun, sind nicht dasselbe. Ich habe zum Beispiel die Fähigkeit, mein Hotelzimmer zu zerlegen, aber keinerlei Disposition dazu. Mit BV für Dispositionen und BV:A für Fähigkeiten lässt sich der Unterschied zwischen Fähigkeiten und Dispositionen aber nicht festmachen. Das folgende Beispiel zeigt das Problem.
Nasenneurose
Bernd hat eine Neurose. Er muss andauernd fühlen, ob seine Nase noch da ist und tippt sich deshalb in allen möglichen Situationen - im Schnitt alle zehn Sekunden - auf die Nasenspitze. Brigitte nervt das tierisch. Sie tippt sich nur auf die Nasenspitze, wenn sie ihrer Freundin auf einer Party ein Zeichen geben will, dass sie gern nach Hause gehen würde.
So, wie Bernd psychisch gestrickt ist, hat er die Disposition, seine Nase zu berühren, in viel höherem Maße als Brigitte mit ihrer psychischen Konstitution. Die Fähigkeit, ihre Nase zu berühren, haben sie (wie wir annehmen können) hingegen in exakt demselben Maße. Mit Vetters Theoriebausteinen lässt sich diese Kombination von Tatsachen nicht einfangen. Bernd berührt seine Nase schließlich in einer eklatant höheren Proportion möglicher Situationen (in denen wir seine psychische Konstitution festhalten) als Brigitte (mit ihrer psychischen Konstitution).
Das Problem ergibt sich aus dem Wegfall der Intention aus der Analyse von Fähigkeiten. Während es bei Dispositionen vollkommen plausibel ist, dass der Grad der Disposition steigt, je öfter man ein entsprechendes Verhalten zeigt, steigt der Grad einer Fähigkeit nicht schlichtweg dadurch, dass man eine Handlung ganz oft ausführt.10 Was entscheidend ist, im Fall von Fähigkeiten, ist vielmehr, wie oft es einem gelingt, die Handlung auszuführen - wie oft man erfolgreich ist. Es hat also damit zu tun, wie regelmäßig man es schafft, seine Intention, die Handlung auszuführen, in die Tat umzusetzen. Fähigkeiten, das können wir an dieser Stelle ganz deutlich sehen, haben etwas mit der modalen Erfolgsquote einer Akteurin zu tun. Und diese modale Erfolgsquote besteht in der Verbindung zwischen Intention und Ausführung über mögliche Situationen hinweg.
BV mag für Dispositionen die richtige Analyse liefern; für Fähigkeiten zum Handeln hingegen ist ausgerechnet eben jenes Verhältnis zwischen Intention und Ausführung relevant, das in der Analyse verloren geht, wenn wir alle, und nicht nur die Intentionssituationen, in Betracht ziehen.
3. Nicht-Handlungsfähigkeiten
Ich habe in der letzten Sektion ganz bewusst nur über Fähigkeiten gesprochen, Handlungen auszuführen. Für Fähigkeiten dieser Art - „Handlungsfähigkeiten“, wie wir sie nennen können, - ist Vetters Analyseschema ungeeignet, weil die Fähigkeit, eine Handlung auszuführen, mit der modalen Verbindung zwischen Intention und Ausführung zu tun hat.
Daneben gibt es allerdings eine ganze Reihe von Fähigkeiten, bei denen die Intention der Akteurin überhaupt keine hervorgehobene Rolle spielt. Die Fähigkeit, zu riechen, ist so ein Fall. Wahrnehmungsfähigkeiten insgesamt. Die Fähigkeit, seinen Kindergartenfreund 30 Jahre später auf der Straße wiederzuerkennen. Mustererkennungsfähigkeiten. Die Fähigkeit, in passender Weise auf Gründe zu reagieren. Die Fähigkeit, beim Lügen nicht rot zu werden. Die Fähigkeit, zu lieben.
All diese Fähigkeiten haben gemeinsam, dass sie sich nicht plausiblerweise unter Rückgriff auf die Verbindung zwischen Intention und Ausführung analysieren lassen. Wozu die Akteurin eine Fähigkeit hat, ist keine Handlung. Es muss also überhaupt keine Intention vorangegangen sein. Wir können hier mangels eines eleganteren Ausdrucks von „Nicht-Handlungsfähigkeiten“ sprechen.
Im Fall von Nicht-Handlungsfähigkeiten sieht Vetters Analyseschema für Dispositionen plötzlich wieder ganz plausibel aus. Die Fähigkeit, zu lieben, hat man, wenn man in einer hinreichenden Proportion möglicher Situationen liebt (und zwar, ob man will oder nicht). Die Fähigkeit, zu riechen, hat man, wenn man in einer hinreichenden Proportion möglicher Situationen Gerüche wahrnimmt. Die Fähigkeit, beim Lügen nicht rot zu werden, hat man, wenn man in einer hinreichenden Proportion von Situationen, in denen man lügt, nicht rot wird. Die Einschränkung auf Situationen, in denen die Person ihr Verhalten intendiert, würde uns verzerrte Ergebnisse liefern.
Bei Handlungsfähigkeiten war der Einwand gegen Vetters Analyseschema, dass es den Unterschied zwischen der Fähigkeiten, ϕ zu tun, und der Disposition, ϕ zu tun, verwischt. Interessanterweise stellt sich dieses Problem im Fall von Nicht-Handlungsfähigkeiten aber gar nicht. Vielmehr fallen die Fähigkeit, ϕ zu tun, und die Disposition, ϕ zu tun, zusammen, wenn ϕ keine Handlung ist. Je stärker ich disponiert bin, zu lieben, desto höher ist der Grad meiner Fähigkeit, zu lieben. Je stärker ich disponiert bin, Gerüche wahrzunehmen, desto höher ist der Grad meiner Fähigkeit, zu riechen. Je stärker meine Disposition ist, beim Lügen nicht rot zu werden, desto höher ist der Grad meiner Fähigkeit dazu. Die Fähigkeit und die Disposition fallen in solchen Fällen in eins.
Zudem fällt in diesen Fällen die Intuition weg, dass Fähigkeiten aktiv sind, während Dispositionen passiv sind. Zum Riechen sind wir zugleich disponiert und fähig, aber da es in beiden Fällen ums Riechen geht, ist der Aktivitätsgrad - anders als zum Beispiel beim Begriffspaar „schnüffeln“ und „stinken“ - identisch.
Angesichts dieser Gemeinsamkeiten zwischen Nicht-Handlungsfähigkeiten und Dispositionen stellt sich die Frage, was Nicht-Handlungsfähigkeiten wie die Fähigkeit, zu riechen, zu lieben oder beim Lügen nicht rot zu werden, dann überhaupt zu Fähigkeiten macht. Sieht riechen, lieben und nicht rot werden nicht Vorgängen wie zerbrechen, sich auflösen oder ausflippen viel ähnlicher als dem Springen auf einem Bein, dem Fliegen von Kampfjets oder dem Laufen eines Marathons? Haben wir es bei riechen, lieben und der Beibehaltung seiner üblichen Gesichtsfarbe nicht schlichtweg mit Dispositionen zu tun? Kommen Fähigkeiten vielleicht ausschließlich im Bereich des Handelns vor? Wäre das wahr, dann müssten wir die Rede von Fähigkeiten im Bereich des bloßen Verhaltens aufgeben. Aber es gibt doch die Fähigkeit zu riechen, zu lieben oder zu lügen ohne rot zu werden. Was ist hier los?
4. Die Teleologische Fähigkeitstheorie
Die Antwort hat mit Zwecken zu tun. Die Fähigkeit, zu riechen, hat zwar in der Tat viele Gemeinsamkeiten mit paradigmatischen Fällen von Dispositionen. Aber sie hat auch eine entscheidende Gemeinsamkeit mit der Fähigkeit, einen Kampfjet zu fliegen. Beide Verhaltensweisen - riechen und einen Kampfjet fliegen - dienen einem Zweck. Riechen ist zweckdienlich, insofern es uns Menschen einen evolutionären Vorteil verschafft. Einen Kampfjet zu fliegen ist zweckdienlich, insofern es eine Intention in die Tat umsetzt. Der Zweck ist durch die Absicht der Akteurin gesetzt; zweckdienlich ist, was diese Absicht umsetzt.
Zu Zwecken insgesamt gleich mehr. Wichtig an dieser Stelle ist: Im Fall von Handlungen kann die Rede von „Zweckdienlichkeit“ in mehreren Weisen verstanden werden. Die Aussage „Handlung ϕ ist zweckdienlich“ kann einerseits so verstanden werden, dass die Handlung die Intention der Akteurin in die Tat umsetzt. Der Zweck, der durch die Intention, ϕ zu tun, in die Welt kommt, besteht im ϕ-Tun. Das ist der Sinn, in dem ich von Zweckdienlichkeit spreche. Man kann die Aussage aber auch so verstehen, dass das Ausführen der Handlung einem weiteren Zweck dient. Beispiel: Indem ich meine Mutter anrufe, mache ich sie glücklich. Hier ist die Handlung - der Anruf - ein Mittel zu einem darüber hinausgehenden Zweck - das Glück meiner Mutter - und in diesem Sinne zweckdienlich. Dieser Sinn von Zweckdienlichkeit ist auf interessante Weise mit dem anderen Sinn verzahnt, kann aber an dieser Stelle ausgeklammert werden. Konzentrieren wir uns auf den Fall, in dem die Intention den Zweck in die Welt setzt, die intendierte Handlung auszuführen.
Wie stehen nun Fähigkeiten und Dispositionen zueinander? Fähigkeiten, so meine These, sind Dispositionen einer bestimmten Art, nämlich Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten. In den offensichtlichsten Fällen von Fähigkeiten - zum Beispiel der Fähigkeit einen Kampfjet zu fliegen - haben wir es mit Fähigkeiten zu intentionalen Handlungen zu tun. In diesen Fällen ist die Zweckdienlichkeit des Verhaltens quasi eingebaut: Dass eine intentionale Handlung zweckdienlich ist, liegt darin begründet, dass sie intendiert wurde. Die intentionale Handlung setzt die Intention der Akteurin in die Tat um. In anderen Fällen von Fähigkeiten - der Fähigkeit zu riechen etwa - liegt die Zweckmäßigkeit darin begründet, dass es sich um eine, in diesem Fall biologische, Funktion handelt.
Es ergibt sich folgendes Bild: Fähigkeiten und Dispositionen voneinander unterscheiden zu wollen, ist ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Fähigkeiten sind Dispositionen, und zwar Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten. Wann immer das Verhalten, zu dem jemand oder etwas disponiert ist, zweckdienlich ist, haben wir es mit einer Fähigkeit zu tun. Manchmal sind die Zwecke durch die Intention eingebaut. Manchmal sind sie dadurch gegeben, dass das Verhalten eine Funktion hat. In wieder anderen Fällen wird der Zweck durch die Zuschreiberin gesetzt. Aus offensichtichen Gründen nenne ich diese Auffassung „die teleologische Fähigkeitstheorie“.
Bei der Ausformulierung der Theorie kommt es natürlich darauf an, wie man über Dispositionen denkt. Entlang Vetters Analyseschema für Dispositionen können wir sagen:
TELOS:BV Eine Akteurin hat genau dann die Fähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen ϕ zweckdienlich ist, ϕ tut.
Jemand hat also die Fähigkeit zu riechen genau dann, wenn die Person in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen riechen zweckdienlich ist, riecht. Jemand hat die Fähigkeit, beim Lügen nicht rot zu werden, genau dann, wenn die Person in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen es zweckdienlich ist, beim Lügen nicht rot zu werden, nicht rot wird.
Entlang Manley und Wassermans Analyseschema für Dispositionen ergibt sich entsprechend:
TELOS:M&W Eine Akteurin hat genau dann die Fähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen ein Stimulus für ϕ vorliegt und ϕ zweckdienlich ist, ϕ tut.
In diesem Fall hat also jemand die Fähigkeit zu riechen genau dann, wenn die Person in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen ein Stimulus fürs Riechen vorliegt und riechen zweckdienlich ist, riecht. Jemand hat die Fähigkeit, beim Lügen nicht rot zu werden, genau dann, wenn die Person in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen ein Stimulus fürs nicht-rot-werden vorliegt und es zweckdienlich ist, beim Lügen nicht rot zu werden, nicht rot wird.
Vetters Analyseschema zeigt sich an dieser Stelle als das elegantere. Was ist der Stimulus fürs beim-Lügen-nicht-rot-werden? Dass man lügt? Was ist der Stimulus fürs Riechen? Dass es etwas zu riechen gibt? Vetter muss sich diese Fragen nicht stellen. Es kann sich in schlechthin jeder Situation als zweckdienlich erweisen, zu riechen oder beim Lügen nicht rot zu werden. Einen konkreten Stimulus muss es gar nicht geben. Wie schon bei Dispositionen sprechen Fälle, in denen die Stimulusbedingungen völlig unklar sind, für eine Analyse, die den Stimulus ganz fallen lässt und sich ausschließlich auf die Manifestations- bzw. die Ausübungsquote in den möglichen Situationen insgesamt konzentriert.
Interessante Konsequenz der teleologischen Fähigkeitstheorie: Für Handlungsfähigkeiten ergibt sich in beiden Fällen dieselbe Analyse. Handlungen sind zweckdienlich, wenn sie eine entsprechende Intention umsetzen. Also lässt sich TELOS:BV im Fall von Handlungsfähigkeiten auf die folgende Weise umformen:
TELOS:BV:HF Eine Akteurin hat genau dann die Handlungsfähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen eine Intention, ϕ zu tun, vorliegt, ϕ tut.
IN TELOS:MW lässt sich ebenfalls eine Einsetzung machen. Gegeben, dass der Stimulus für eine Handlung stets die Intention ist, die Handlung auszuführen, lässt sich die Analyse umformen zu:
TELOS:M&W:HF Eine Akteurin hat genau dann die Fähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen sie intendiert, ϕ zu tun, und ϕ zweckdienlich ist, ϕ tut.
Gegeben, dass eine Handlung immer dann zweckdienlich ist, wenn sie eine Intention, die Handlung auszuführen, umsetzt, können wir den Nachsatz „und PHI ist zweckdienlich“ eliminieren. Das Ergebnis ist nichts Anderes als TELOS:BV:HF.
Für Handlungsfähigkeiten spielt es also keine Rolle, wie man sich Dispositionen genau vorstellt. Wenn Fähigkeiten Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten sind, dann gilt für Handlungsfähigkeiten:
TELOS:HF Eine Akteurin hat genau dann die Handlungsfähigkeit, ϕ zu tun, wenn sie in einer hinreichenden Proportion der möglichen Situationen, in denen sie intendiert, ϕ zu tun, ϕ tut.
5. Zuschreiberzwecke
In einigen Fällen ist ϕ weder eine intentionale Handlung, noch hat ϕ eine biologische, soziale oder sonst irgendeine Funktion. Dennoch bedienen wir uns der Fähigkeitsredeweise. So wie in den beiden folgenden Fällen:
Fall 1
Helga sagt: „Glücklicherweise hat mein handysüchtiger Partner die grandiose Fähigkeit, das Ding dauernd runterfallen zu lassen.“
Fall 2
Heinz sagt: „Für unser Theaterstück brauchen wir noch jemanden mit der Fähigkeit, extrem steif rüberzukommen.“ Heike sagt: „Paul! Das ist unser Mann. Paul ist sowas von steif, der muss gar nicht spielen.“
Klarerweise haben wir es in beiden Fällen mit einer Disposition zu tun. Aber sind diese Dispositionen Fähigkeiten? Hier haben wir freie Wahl. Wenn wir sagen wollen, es handle sich um genuine Fähigkeiten, dann können wir das anhand der teleologischen Theorie erklären. Wenn wir sagen wollen, es handle sich nicht um eine genuine Fähigkeit, erklärt uns die teleologische Theorie, wieso sich die Zuschreiberinnen dennoch der Fähigkeitenredeweise bedienen.
Schließlich sind ja in beiden Beispielen Zwecke im Spiel. In beiden Fällen projiziert eine Person - die Zuschreiberin der Fähigkeit - ihre eigenen Zwecke in das Verhalten eines Akteurs hinein. Helga ist froh, dass ihr Partner die Disposition hat, sein Handy fallenzulassen. Es ist ihren eigenen Zwecken dienlich. Analog: Heike ist froh, dass Paul so steif rüberkommt, denn damit hat Paul genau die Disposition, die Heike zweckdienlich ist. Sowohl der handysüchtige Partner als auch Paul haben also Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten. Bloß handelt es sich eben nicht um die Zwecke des Akteurs oder um Zwecke, die durch genuine Funktionen in die Welt kommen, sondern um die Zwecke der Fähigkeitszuschreiberin.
Aus meiner Sicht hängt nicht viel daran, ob wir in solchen Fällen von genuinen Fähigkeiten sprechen wollen oder nicht. Wenn ja, dann kann das die teleologische Theorie einfangen, indem sie auch Zuschreiberzwecke zulässt. Wenn nein, dann sollten wir Zuschreiberzwecke ausschließen. Dass Zuschreiber in Fällen, in denen eine Disposition ihren eigenen Zwecken dienlich ist, dennoch in die Fähigkeitsrede verfallen, erklärt die teleologische Theorie sehr gut: Der entscheidende Marker für Dispositionen, die außerdem Fähigkeiten sind, ist deren Zweckmäßigkeit. Dass man dann auch etwas lose von Fähigkeiten spricht, wenn eine Disposition den eigenen Zwecken dient, ist nicht allzu überraschend. Ob wir in Fall 1 und 2 von genuinen Fähigkeiten sprechen wollen, ist Geschmackssache.
6. Fazit
Obwohl Fähigkeiten und Dispositionen einige Unterschiede aufzuweisen scheinen, ist es in vielen Fällen alles andere als offensichtlich, ob es sich bei einer bestimmten modalen Eigenschaft um eine Fähigkeit oder eine Disposition handelt. Trinkfestigkeit, ein gutes Erinnerungsvermögen, ein einnehmendes Lachen oder die Eigenschaft, unfreiwillig komisch zu sein; sehen, hören, oder riechen; Rationalität - in all diesen Fällen können wir ebenso gut von einer Fähigkeit wie von einer Disposition sprechen.
Der Grund für diese Unklarheit ist, dass der Unterschied zwischen Fähigkeiten und Dispositionen weniger trennscharf ist, als gemeinhin angenommen. Fähigkeiten sind Dispositionen; und zwar Dispositionen zu zweckdienlichem Verhalten.
Die Vorstellung, Fähigkeiten und Dispositionen seien grundlegend verschieden, liegt allein darin begründet, dass der Zweck im Fall von Handlungsfähigkeiten durch die Intention der Akteurin gesetzt ist. Aus diesem Grund gilt: 1) Handlungsfähigkeiten sind aktiv, Dispositionen passiv; 2) die Handlungsfähigkeit, ϕ zu tun, und die Disposition, ϕ zu tun, sind nicht dasselbe.
Im Falle von Nicht-Handlungsfähigkeiten verschwimmen diese Unterschiede aber. Das liegt daran, dass Intentionen hier keine Rolle spielen. Die Zweckmäßigkeit von Nicht-Handlungsfähigkeiten ist dem teleologischen Charakter von Funktionen geschuldet. Oder - in einem sehr liberalen Bild - den Zwecken der Zuschreiber von Nicht-Handlungsfähigkeiten.
Die neuen Dispositionalisten haben also Recht: Fähigkeiten sind Dispositionen. Die teleologische Fähigkeitstheorie sagt uns, welche. Eine Fähigkeit zu haben, heißt, eine Disposition zu zweckdienlichem Verhalten zu besitzen.