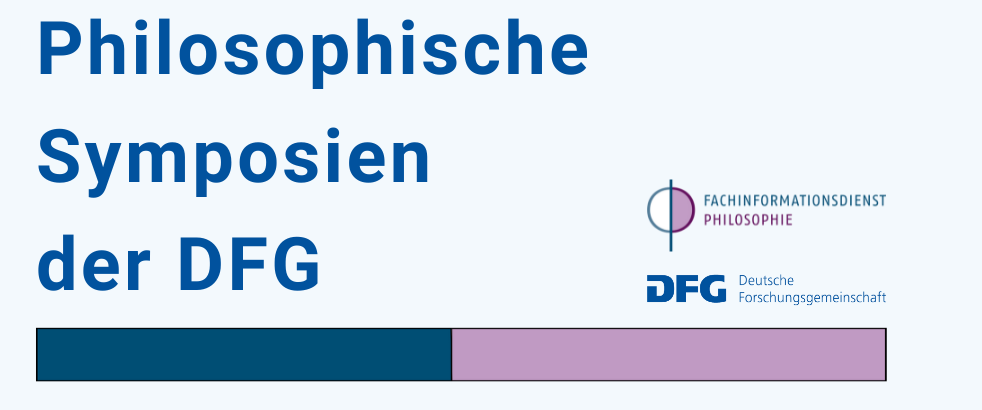Potentialität in der Ethik Spinozas
Beitrag zum Philosophischen Symposium 2019 der Deutschen Foschungsgemeinschaft (DFG)
Potentialität in der Ethik Spinozas
Die Frage der Potentialität spielt im Denken Baruch de Spinozas eine wesentliche Rolle und stellt einen systematischen Höhepunkt seines Hauptwerks von 1677 dar. Für die Interpretation der Ethica als Metaphysik ist Potentialität ebenso wichtig wie für ihre Interpretation als Ethik. Dementsprechend kommt weder die ontologische Bestimmung der grundlegenden Strukturen der Wirklichkeit ohne die Dimension der Potentialität aus noch die ethische Bestimmung der Freiheit des menschlichen Individuums. Mit dem Begriff der Potentialität lässt sich eines der umstrittensten Probleme der Philosophie Spinozas markieren: Es ist das Problem von Determinismus und Freiheit und damit die Frage, ob der immer wiederkehrende Rückbezug auf das Ganze der einen Natur für die menschlichen Individuen einen Determinismus darstellt oder ob sie ihre Möglichkeiten in dieser Natur frei realisieren können.
Im Folgenden möchte ich dafür argumentieren, dass mit Spinozas ontologischem Modell der Substanz, der Attribute und der Modi, wie es im ersten Teils der Ethica dargelegt wird, nicht nur eine essentielle Einheit determinierter Einzeldinge ausgewiesen wird, sondern ein Möglichkeitsspielraum immanenter Individuation. Potentialität soll dabei vom Begriff der potentia her und damit als ein immanentes Machtprinzip rekonstruiert werden, durch das die dynamischen Wirkungszusammenhänge der Natur auch als Handlungszusammenhänge der menschlichen Individuen erkennbar werden. Die systematische Verbindung von Metaphysik und Ethik, durch die sich Spinozas System auszeichnet, erlaubt es, das allgemeine Seinsprinzip der Potentialität auf die menschlichen Individuen zu übertragen. So ist der metaphysische Begriff der potentia als die potentia agendi eines jeden Individuums und damit als dessen individuelle Handlungsmacht zu verstehen. Die Potentialität der Natur wird auf diese Weise zu einer Possibilität der menschlichen Individuen, die in der Lage sind, sich von der Determination durch die kausalen Bedingungen ihrer Existenz abzuheben und ihre Möglichkeitsspielräume auszuloten.
Immanente Ontologie und Potentialität
Spinoza beginnt sein Hauptwerk mit einer Theorie der elementaren Dimensionen der Wirklichkeit und mit der Bestimmung einer Essenz, die Ursache und Voraussetzung ihrer selbst ist und ihre eigene Existenz einschließt. Mit der paradoxen Figur der causa sui stellt er eine immanente Selbstursache an den Anfang, um sein System ohne transzendente Herleitungen aufzubauen. „Unter Ursache seiner selbst [per causam sui] verstehe ich das, dessen Essenz Existenz einschließt, anders formuliert das, dessen Natur nur als existierend begriffen werden kann (E1d1).“1 Im Horizont der so begründeten Immanenz findet Spinoza die Freiheit, die Natur als Ganzes nach ihren eigenen Bedingungen und in ihrer immanenten Kausalität (causa immanens) zu verstehen. Die radikale Selbstständigkeit und Unbedingtheit der einen Substanz, die die Natur für ihn ist, setzt voraus, dass es nichts außer dieser einen Natur geben kann. Sie bringt sich selbst hervor, und in ihr differenziert sich das Verhältnis unendlicher Attribute, von denen die Menschen nur Ausdehnung und Denken zu erfassen in der Lage sind. Spinoza vermeidet jede Hierarchisierung dieser Attribute und siedelt die einzelnen Modi in den immanenten kausalen Verbindungen an, die sich in der einen Substanz ereignen.
Der Begriff der potentia wird bereits im kurzen Traktat über Gott, den Menschen und dessen Glück erwähnt, der ca. 1660 in Vorbereitung der Ethica entstanden und durch eine niederländische Übersetzung erhalten ist.2 Macht wird hier mit den niederländischen Begriffen von magt, kragt oder mogentheid als die Macht Gottes ausgewiesen.3 Als ein allgemeines Seinsprinzip, das die Rede von einer Ontologie der Macht und ihre Darstellung als ein metaphysisches Prinzip rechtfertigt, findet sich die potentia aber erst in der Ethica und ist hier als Macht Gottes und damit, gemäß der folgenreichen Gleichsetzung von Gott und Natur in der berühmten Formel deus sive natura, als eine Macht der Natur erkennbar. „Denn, da imstande sein zu existieren, Macht (potentia) ist, folgt, daß je mehr Realität der Natur eines Dinges zukommt, es umso mehr Kraft (virium) aus sich heraus hat zu existieren. Mithin muß ein unbedingt unendliches Seiendes, also Gott, aus sich heraus eine unbedingt unendliche Macht haben zu existieren, und deshalb existiert er in unbedingter Weise“ (E1p11s). Es fällt den Menschen schwer, so Spinoza, diese Unbedingtheit Gottes zu verstehen, „weil sie gewohnt sind, allein diejenigen Dinge zu betrachten, die aus äußeren Ursachen hervorgehen“ (E1p11s). Gott erhält sich aber aus einer immanenten Potentialität und wird von keiner äußeren Ursache hervorgebracht, was bereits aus Lehrsatz 6 des ersten Teils der Ethica folgt, wo festgestellt wird, dass eine Substanz nicht von einer anderen Substanz hervorgebracht werden kann. Gott und die Natur ergeben sich aus einer Potentialität, die ihre Essenz selbst ist: „Gottes Macht ist genau seine Essenz“ (E1p34). Aus der Gleichsetzung von Gott und Natur folgt also, dass Potentialität als potentia auch die Essenz (essentia) der Natur und damit die Essenz eines jeden Individuums im Ganzen der Natur ist. Da die Essenz der Dinge für Spinoza ihre Existenz (existentia) ist, wie bereits in der oben angeführten ersten Definition des ersten Teils der Ethica festgestellt wird, können wir die potentia als das essenzielle Grundprinzip der Existenz eines jeden Individuums bestimmen. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff der Potenzialität die grundlegende Möglichkeit eines jeden Individuums, zu existieren und sich selbst zu erhalten, wie hier an der Darstellung der unendlichen Macht Gottes, die zugleich die Macht der Natur und damit auch die der menschlichen Individuen ist, deutlich wird.
Spinoza setzt seinen ontologischen Grundbegriff der Substanz (substantia) mit Gott und der Natur in eins und markiert seine immanente Anlage: „Unter Substanz verstehe ich das, was in sich selbst ist (in se est) und durch sich selbst begriffen wird, d. h. das, dessen Begriff nicht des Begriffs eines anderen Dinges bedarf, von dem her er gebildet werden müßte“ (E1d3).4 Dass die Substanz in sich selbst ist, bedeutet, dass sie aus sich selbst heraus existiert, nicht in etwas anderem ist (in alio est) und nicht erst von etwas anderem in Kraft gesetzt wird. Die radikale Selbstständigkeit und Unbedingtheit der Substanz als Ursache ihrer selbst setzt voraus, dass es nur eine Substanz geben kann, da jede neben ihr existierende Wirklichkeit sie begrenzen würde. Im Unterschied zur immanenten Substanz, die aus sich selbst hergeleitet wird, sind die Attribute und die Modi in Spinozas ontologischer Grundstruktur stets in einem anderen und werden erst durch etwas anderes begreifbar. Dieser Grundsatz geht aus dem ersten Axiom des ersten Teils hervor: „Alles, was ist, ist entweder in sich selbst oder in einem anderen“ (E1a1). In der Gegenüberstellung von unbedingter Substanz und bedingten Modi wird die Selbstständigkeit der Substanz deutlich, und da diese nur aus sich selbst zu begreifen ist, die Modi aber ohne die Substanz nicht zu begreifen sind, ist für Spinoza klar, dass nichts ohne die Substanz, also ohne Gott oder die Natur, sein oder begriffen werden kann und alles in der Natur aus ihrer Notwendigkeit bewirkt wird.5 Die für den Menschen erkennbaren Dimensionen der Substanz sind die Attribute der Ausdehnung und des Denkens, und so ist die Substanz zwar in ihren Attributen auf verschiedene Weise erkennbar, bleibt aber gleichwohl eine einzige Substanz: „In der Natur kann es nicht zwei oder mehrere Substanzen derselben Natur, d. h. desselben Attributs, geben“ (E1p5). Unterschiedliche Substanzen sind nur aufgrund ihrer verschiedenen Attribute oder aufgrund ihrer verschiedenen Affektionen, die sich als Modifikationen der Substanz, also als ihre Modi, zeigen, verschieden. Das bedeutet, es gibt eine Verschiedenheit der Attribute und eine Verschiedenheit der durch Affektionen bewirkten Modifikationen der Substanz, aber eben keine Verschiedenheit der Substanz selbst.
Die Stellung des Substanzbegriffs und seine Funktion als erster Grundbegriff des immanenten Systems müssen aufgezeigt werden, um die Rolle der Potentialität im Denken Spinozas zu rekonstruieren. Spinoza nutzt den Begriff der Substanz, um den Zusammenhang der Elemente des ontologischen Modells der Wirklichkeit abstrahierend und modellhaft darzustellen. In dieser Struktur und in dieser Funktion muss der Substanzbegriff vorerst von allen subjekttheoretischen Anklängen freigehalten werden und darf nicht vorschnell mit der Frage nach dem Menschen und der menschlichen Lebensform in Verbindung gebracht werden. Als einer nominalen Einheit des ontologischen Modells ist der Substanz keine Spur menschlicher Individualität eigen, obwohl die menschlichen Individuen für Spinoza durch die Attribute der Ausdehnung und des Denkens vermittelte Modi der Substanz sind. Substanz ist also immanent und singulär, d. h., es kann nur die eine absolute und unendliche Substanz geben. Mit ihrer Unendlichkeit wird auch ihr affirmativer Charakter ausgewiesen, denn durch ihre Unendlichkeit ist alles in positiver Weise in ihr vorhanden, und es gibt keine Negativität. „Weil endlich sein der Sache nach eine partielle Verneinung ist und unendlich sein die unbedingte Bejahung der Existenz irgendeiner Natur, folgt […] dass jede Substanz unendlich sein muss“ (E1p8s). Würde Substanz für endlich gehalten, so würden sich aus ihrer Begrenztheit ein ihr äußerer Bereich und eine Negativität ergeben, also eine partielle Verneinung, die ihrem immanenten Charakter entgegenstehen würde. Mit der Annahme, dass die Substanz vollumfänglich ist und alles in ihrer Immanenz angelegt ist, werden die relationalen Affirmationsverhältnisse der in ihr enthaltenen Einzeldinge deutlich gemacht.
Es ist höchst umstritten, ob die Substanz ihren Affektionen und den sich daraus ergebenden unterschiedlichen Modi vorgeordnet ist. Wenn Substanz etwas ist, das in sich selbst durch sich selbst ist (vgl. E1d3), und Modi das sind, was in einem anderen ist (vgl. E1d5), dann wird klar, was Spinoza in E1p1 betont, nämlich die Vorgängigkeit der Substanz vor ihren Affektionen: „[Eine] Substanz geht der Natur nach ihren Affektionen voran“ (E1p1).6 Die in der Einheit der Substanz herrschende Vielheit der Modi wird durch ihre interne Selbstmodifikation hervorgebracht, doch wie hier anklingt, bleibt die Substanz dabei eine grundlegende und fundierende Einheit. Auf diese Weise entsprechen sich die Modi in ihrer Substanz, d. h., sie können nicht vollkommen anders sein, als sie als Modi der einen Substanz sind, und bleiben in ihren essentiellen Voraussetzungen identisch. In dieser Weise ist Spinozas Substanzkonzeption determinierend, und aus ihr ergibt sich eine essentielle Notwendigkeit für die Individuation der einzelnen Modi.7
Spinoza macht aber auch deutlich, dass die Substanz über weit mehr als nur die zwei erkennbaren Attribute verfügt und die Zahl der Attribute von der Realität eines jeden Dinges abhängt: „Je mehr Realität oder Sein ein jedes Ding hat, umso mehr Attribute kommen ihm zu“ (E1p9). Mit der Steigerung der Realität, d. h. der Vollkommenheit eines Dings, steigert sich auch die Zahl seiner Attribute, und d. h., dass wir es in der Vollkommenheit Gottes – und den seiner Erkenntnis nahekommenden höheren Erkenntnisstufen – mit einer je höheren Anzahl von Attributen zu tun haben. Diese Überschreitung des cartesianischen Schemas zweier Attribute, die für Descartes eben zwei Substanzen sind, in die Unendlichkeit eröffnet für Spinoza einen Möglichkeitsraum, d. h. eine Potentialität der Erkenntnis, die sich über das dualistische Schema zweier Attribute hinaus steigern kann.8Erfahrung und Erkenntnis erschöpfen sich für Spinoza nicht in einer starren Ordnung der Ausdehnung und des Denkens, sondern weisen eine Potentialität auf, die diese Ordnung überschreitet. Spinoza kann über Descartes hinausgehen, indem er die vertikale Hierarchisierung der Attribute ausschließt und den aporetischen Charakter der cartesischen Verhältnisbestimmung von Ausdehnung und Denken dynamisiert. So gibt es für ihn keine Überordnung des Intelligiblen über das Körperliche, des Cogito über die Ausdehnung, des Subjekts über die Objekte, sondern nur die immanente Natur, die in zwei parallelen Dimensionen erkennbar ist und sich in mannigfaltigen Verbindungen modifiziert. Dabei sind die Modifikationen eines Attributs jeweils auch im anderen Attribut erkennbar, d. h., Modifikationen der Ausdehnung sind immer auch Modifikationen des Denkens und umgekehrt. Mit Blick auf die Frage der Potentialität ist also festzuhalten, dass die Substanz zwar einen privilegierten Seinsrang und damit eine determinierende Funktion hat, dass in ihr aber eine Potentialität der Modi angelegt ist, die sich dynamisch individuieren und in den kausalen Relationen ihrer Umgebung immer wieder neu konstituieren.
Um nun weiter zu bestimmen, wie die innere Komplexität der Substanz und die Potentialität der Einzeldinge unter den bisher genannten Voraussetzungen zustande kommen, ist es nötig, Spinozas Konzeption der Modi genauer zu betrachten. Im Unterschied zur Substanz selbst stehen die Modi stets in einem über sie hinausgehenden Zusammenhang und unterliegen dem Gesetz der immanenten Kausalität. Der Begriff des modus entfaltet seine Bedeutung erst im Gefüge der Substanz und ihrer Attribute, und Modi werden als Affektionen von Substanz vorgestellt.9 Sie bilden die dritte zentrale Kategorie des ontologischen Modells, das Spinoza seiner Ethik zugrunde gelegt hat: „Unter Modus verstehe ich die Affektionen [affectiones] einer Substanz, anders formuliert das, was in einem anderen ist, durch das es auch begriffen wird“ (E1d5). Mit dieser Definition werden die Modi bereits im ersten Teil der Ethica vom Vorgang der Affektion her ausgewiesen und als Affektionen der Substanz bestimmt. So gewinnt das dynamische Affektionsgeschehen zwischen den Modi eine ontologische Kontur, die weit über die Bedeutung des Affektbegriffs im Kontext der Affektenlehre des dritten Teils der Ethica hinausgeht. Erst durch Affektionen individuieren sich endliche Modi aus der unendlichen Substanz des Ganzen, und damit ist ein einzelnes Seiendes nichts als eine durch Affektionen entstandene Modifikation der Substanz.10
Spinozas Bestimmung der Modi ist also keine Bestimmung fixer Entitäten, sondern eine Bestimmung dynamischer Modifikationen der einen Substanz.11 Ihre Modifikation steht somit nicht im Widerspruch zur Determination durch Substanz, sondern der Vorgang der Modifikation eröffnet gerade die Möglichkeit, die Variabilität der Substanz in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen zu denken.12 Modi sind also Modifikationen der Substanz, die durch Affektionen individuiert werden und sich parallel im Attribut des Denkens und im Attribut der Ausdehnung zeigen. Sie bilden sich durch ein dynamisches Affektionsgeschehen in der Substanz aus, und damit bleibt offen, ob diese ihnen vorhergeht und ihnen vorausgesetzt bleibt oder nicht. Mit anderen Worten, ob wir es bei Spinozas Substanzontologie mit einem Essentialismus zu tun haben, also mit der Annahme einer fundierenden Essenz, aus der die Modi in ihrem Wesen hergeleitet und auf die sie zurückgeführt werden, oder nicht, ist unklar. Wichtig ist, dass Modi stets in einem anderen sind [quod in alio est] und erst von anderem her begriffen werden können, d. h., ein Modus ist nicht ein einzelnes Seiendes, sondern existiert in konstitutiver Relation zu anderen Modi, durch die er affiziert wird. So bleibt die Substanz des Ganzen letztlich der ursächliche Zusammenhang der Modi und die Modi vermittelte Ausdruckformen der Macht Gottes und der Natur. Sie hängen also von der Substanz als ihrer notwendigen Grundlage ab und gehen aus ihr hervor, aber nicht in unmittelbarer Weise, sondern vermittelt durch die Affektionen in den Attributen der Ausdehnung und des Denkens.13 So ist der Körper ein Modus, der die Substanz unter dem Aspekt der Ausdehnung ausdrückt, wie die Ideen Modi sind, die die Substanz unter dem Aspekt des Denkens ausdrücken. Ein Modus ist also stets zugleich ein einzelnes Individuum, das sich in der Dynamik der Affektionen bildet, und ein Teil der ganzen Substanz, durch die es determiniert ist. In den Modi zeigt sich für Spinoza das Verhältnis der endlichen einzelnen Dinge zum unendlichen Ganzen, und wir können die Existenz der Modi nicht ohne die Existenz des Ganzen begreifen.
In dieser Herleitung ist aber ein antiessentialistischer Zug auszumachen, da die Modi nicht aus einer letzten Substanz konstituiert werden, sondern aus den relationalen Affektionsverhältnissen, in denen sie stehen, die sie in unterschiedlicher Weise erfahren, erkennen und bis zu einem gewissen Grad steuern können. Dem Begriff der Konstitution kommt damit eine doppelte Bedeutung zu, denn er bezeichnet sowohl die relationale Wechselwirkung zwischen Entitäten, die sich gegenseitig konstituieren (constituere), wie auch die Verfasstheit und den spezifischen Zustand eines Dinges im Sinne seiner jeweiligen Konstitution (constitutio).14 Mit der Frage der Konstitution der Modi gerät eines der interessantesten Probleme im Denken Spinozas in den Blick, nämlich die Frage, wie die variable Vielheit unterschiedlicher Einzeldinge überhaupt mit der einen Substanz des Ganzen in Einklang zu bringen ist. Es versteht sich nicht von selbst, dass es verschiedene Modi geben kann, wenn es nur eine Substanz gibt, und ebenso wenig versteht es sich, wie die dynamische Potentialität dieser Modi in der einen Substanz zu erfassen ist. Es hängt also auch von der Bestimmung der Modi ab, wie das Verhältnis der unterschiedlichen Einzeldinge zur fundierenden Substanz des Ganzen aufzufassen ist und wie dementsprechend auch die menschlichen Individuen in ihrer Potentialität zu verstehen sind. Mit Spinozas ontologischer Konzeption von Substanz muss also eine essentielle Form ausgewiesen werden, die mit der Potentialität erkenntnis- und affektfähiger menschlicher Individuen vereinbar ist.
Im weiteren Verlauf der Ethica profiliert Spinoza das menschliche Individuum in seiner Handlungsmacht und verleiht ihm damit das Vermögen, sich mithilfe seiner Erkenntnis- und Affektfähigkeit zu orientieren und zu individueller Freiheit zu gelangen. Die Potentialität der Modi ist also mit der essentiellen Notwendigkeit der Substanz in Einklang zu bringen, und ihre Notwendigkeit ist aus der Notwendigkeit der Natur herzuleiten. An der folgenden kurzen Darstellung des Verhältnisses von natura naturans und natura naturata soll deutlich werden, dass bereits Spinozas Auffassung von Natur selbst eine Dimension der Potentialität aufweist.
Potentialität der Natur
Anhand der Unterscheidung von natura naturans und natura naturata lässt sich auch die Natur selbst im Sinne einer Potentialität ausweisen. Der Begriff der natura wird von Spinoza nicht in derselben systematischen Weise bestimmt wie die der Substanz, der Attribute und der Modi. Zwar verwendet er ihn immer wieder, aber gleichwohl verlässt er sich auf die scholastische Bedeutung und fasst natura zumeist im allgemeinen Sinne einer Aktivität auf, die gleichzeitig hervorbringende Kraft und Effekt einer hervorbringenden Kraft ist.15 In Spinozas immanenter Konzeption der Natur zeigt sich ein metaphysischer Naturalismus, der sich nicht in physikalischen Erklärungen erschöpft, sondern naturphilosophisch geprägt ist und durch den die Potentialität der Natur selbst zur Grundlage der Individuation wird.16 Die Macht der Natur ist immer und überall dieselbe, „d. h. die Gesetze und Regeln der Natur, nach denen alles geschieht und aus einer Form in eine andere sich verändert sind immer und überall dieselben“ (E3praef), und das bedeutet auch, dass ein jedes Einzelding, also ein jedes Individuum, nach den Gesetzen und Regeln der Natur zu verstehen ist. Die Konzeption von natura naturans und natura naturata ist auf einen Begriff der Natur gegründet, wie er dem lateinischen Verb naturare zugrunde liegt, das den aktiven, hervorbringenden Charakter der natura deutlich macht. Spinoza übernimmt das Doppelkonzept von natura naturans und natura naturata und unterscheidet damit zwischen der Substanz und den Attributen auf der einen und den Modi auf der anderen Seite. Dabei ist Substanz als erschaffende Natur selbständig und durch das Prinzip der causa sui in Kraft gesetzt (und in den Attributen erkennbar), während sie ihrerseits die Modi in Kraft setzt und sich in den Modi ausprägt. Wenn natura naturans die absolute Ursache ist und natura naturata die einzelnen Modi umfasst, wie sie aus der schaffenden Natur folgen, stellt sich die Frage, wie die einzelnen Modi überhaupt für sich zu verstehen sind. Sie müssen von der schaffenden Natur, durch die sie determiniert sind, abgelöst und abstrahiert werden, um als einzelne erkennbar zu sein. Das heißt, dass die Unterscheidung von natura naturans und natura naturata weder wie ein Dualismus noch wie eine Analogie verstanden werden darf, denn in beiden Fällen erscheinen die Modi nur wie Repräsentationen einer ihnen zur Seite gestellten oder vorhergehenden Quelle. Die Natur als natura naturans ist vielmehr eine unbedingte produktive Macht (potentia), die in jedem Ding und jeder Idee zu einem eigenen Ausdruck gelangt, sie ist keine Wesensgrundlage, aus der sich Erscheinungen ableiten, sondern das mannigfaltige Ausdrucksgeschehen der Formen selbst. Sie ist schaffende Natur (natura naturans), während die durch sie zum Ausdruck kommenden Modi geschaffene Natur (natura naturata) sind.
Spinoza macht deutlich, „daß wir unter ,Natura naturans‘ zu verstehen haben, was in sich selbst ist und durch sich selbst begriffen wird, also solche Attribute von Substanz, die eine ewige und unendliche Essenz ausdrücken, d. h. […] Gott, insofern er als freie Ursache angesehen wird. Unter ,Natura naturata‘ […] dagegen alles, was aus der Notwendigkeit der Natur Gottes oder vielmehr der Natur irgendeines seiner Attribute folgt, d. h. alle Modi der Attribute Gottes, insofern sie als Dinge angesehen werden, die in Gott sind und ohne Gott weder sein noch begriffen werden können“ (E1p29s). Spinoza vermeidet die Überordnung eines gesetzgebenden Gottes über die Welt, indem er diesen mit der Natur als einer unendlichen Substanz, aus der alles hervorgeht, immanent und horizontal in eins setzt. Die Individuation des menschlichen Individuums vollzieht sich in dieser Naturkonzeption nicht in Abgrenzung von der Natur und nicht als souveränes Selbstbewusstsein, das die äußere Welt dem eigenen Denken unterwirft. Menschliche Individuen erreichen ihre Freiheit hier nicht durch die Absonderung ihres Denkens von der Natur, sondern dadurch, dass sie sich aktiv als ein Teil der Natur und ihrer immanenten Kausalität erkennen und aus dieser Erkenntnis ihre Macht und ihre Freiheit herleiten.
Mit seiner Vorstellung der Einheit von Gott und Natur wollte Spinoza die Wirklichkeit auf der Grundlage einer Bestimmung des Ganzen erfassbar machen und die Einheit des Ganzen mit ihren vielen Ausdrucksformen in ein modales Verhältnis bringen. Die Einheitsbegriffe von Gott und Natur werden von einem ontologischen Monismus ausgehend verstanden, der die Potentialität und damit die dynamische Pluralität von Formen umfasst. Durch seinen nominalistischen Gebrauch sperrt Spinoza vor allem den Begriff der Substanz gegen seine Verdinglichung und gelangt so zu einer dynamisierenden Desubstanzialisierung des Einheitsdenkens und einem antiessentialistischen Naturbegriff. Mit der Unterscheidung von natura naturans und natura naturata wird die Vorstellung einer dynamischen und in unterschiedlichen Ausdrucksformen wandelbaren Welt deutlich gemacht und der Natur eine Potentialität verliehen.17
Spinozas Natur kann also als eine Instanz verstanden werden, die zwar fundierenden Charakter hat, aber nicht in apriorischer Unabhängigkeit gegen ihre Ausdrucksformen steht, sondern vielmehr in einer immanenten Konzeption ihrer Macht aufgeht. Sie ist nicht einfach eine determinierende Instanz, die den Einzeldingen wie ein Grund vorhergeht, sondern in ihr zeigt sich gerade die Potentialität pluraler Verbindungen und Formen. Unter diesen Voraussetzungen ist Naturalisierung keine Rückführung auf eine vorgängige Wesenseinheit, sondern vielmehr eine Situierung der Einzeldinge in einem horizontalen Feld von Kräften, durch die sie konstituiert werden. Die Freiheit des Menschen wird aus der Erkenntnis seiner selbst in der Natur und als Teil der Natur hergeleitet und muss nicht aus einer epistemischen Frontstellung gegen die Natur begründet werden. Naturalisierung ist für Spinoza eine Möglichkeit, die mannigfaltigen Modi des Ausdrucks der Natur in ihrer Potentialität zu verstehen.18Für Spinoza ist die Natur in all ihren Erscheinungsformen eins und in ihr ist alles in seiner Art vollkommen. Die Vollkommenheit der Dinge in der Natur wird aus der Vollkommenheit Gottes hergeleitet, denn wie in E1p29 deutlich gemacht wird, gibt es in der Natur „nichts Zufälliges, sondern alles ist aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur bestimmt, in einer bestimmten Weise zu existieren und etwas zu bewirken“. Die „Dinge haben auf keine andere Weise und in keiner anderen Ordnung hervorgebracht werden können, als sie hervorgebracht worden sind“ (E1p33). Und daraus folgt, „daß die Dinge in höchster Vollkommenheit von Gott hervorgebracht worden sind“ (E1p33s2). Was also in der Wirklichkeit der Natur ist, ist vollkommen, so wie es ist, und daher gibt es für Spinoza nicht Gutes und Schlechtes in der Natur, sondern die Wirklichkeit der Dinge ist ihre Vollkommenheit. Spinoza fragt aber: „Wenn alles aus der Notwendigkeit von Gottes höchstvollkommener Natur gefolgt ist, woher kommen dann so viele Unvollkommenheiten in der Natur?“ (E1app). Und er begründet die Vollkommenheit der Dinge aus ihrer Potentialität, also aus ihrer Macht im Sinne des metaphysischen Prinzips der potentia, denn gut und schlecht sind für ihn jeweils nur mehr oder weniger entfaltete Potentialität. Spinoza nennt das in seiner Art vollkommen, was in der Natur ist und an der Positivität der Natur teilhat, und er nennt das unvollkommen, was nicht oder graduell weniger an der Natur teilhat. So wird deutlich, warum das, was in der Natur ist, in der jeweiligen Art, in der es in der Natur ist, vollkommen ist, und die Gleichwertigkeit der Dinge wird aus der Immanenz der Natur erklärt. Grundsätzlich ist Spinoza überzeugt, dass nichts in der Natur geschieht, „was ihr selbst als Fehler angerechnet werden könnte; denn die Natur ist immer dieselbe, und was sie auszeichnet, ihre Wirkungsmacht, ist überall ein und dasselbe“ (E3praef). So ist ein jedes Ding in seiner Natur nach den Gesetzen und Regeln der allgemeinen Natur zu begreifen und einer geometrisch geprägten Handhabung zu unterwerfen. Spinoza leitet aus seiner ontologischen Konzeption also eine strikt antimoralische Haltung den so unterschiedlichen Dingen der Natur gegenüber her. Realität und Vollkommenheit sind für ihn ein und dasselbe, weil die unterschiedlichen Dinge in ihrer jeweiligen Form ihr zur individuellen Vollkommenheit realisiertes Vermögen sind, d. h. die Realisierung ihrer Potentialität als einer Macht im Sinne der potentia.
Potentialität der Macht
In diesem metaphysischen Sinne ist Potentialität also eine Macht der Natur und der einzelnen Dinge in der Natur. Der metaphysische Begriff der potentia kann aber nicht einfach auf das menschliche Individuum übertragen werden, sondern die potentia muss erst als ein Prinzip ausgewiesen werden, das in den Individuen als ihre je eigene Potentialität zum Ausdruck kommen kann.19 Spinoza erläutert seine Vorstellung von dieser Potentialität auch in der Naturrechtsbegründung des Tractatus politicus und gelangt hier zur Bestimmung eines metaphysischen Rechtsprinzips: Daraus nun, „daß die Macht der natürlichen Dinge [rerum naturalium potentia], durch die sie existieren und tätig sind, Gottes Macht in ihrer vollen Gegenwärtigkeit ist, ist leicht ersichtlich, was das Recht der Natur ist“ (TP 2:3 und vgl. auch TP 2:4). Auch im Tractatus theologico-politicus bestimmt er die Macht der einzelnen Dinge als Macht Gottes, und so kann festgehalten werden, dass Macht ein immanentes Seinsprinzip ist, das als Potentialität eines jeden Individuums zum Ausdruck kommt und durch das sich Individuen individuieren.20 Es gibt für Spinoza keine Individuation ohne diese Potentialität, die als immanentes Konstitutionsprinzip immer schon an der Hervorbringung von Individuen beteiligt ist und sie in einen durch die Natur bedingten Möglichkeitsraum stellt. In einer holistischen Perspektive lässt sich also der gesamte Seinszusammenhang als ein Zusammenhang ausweisen, in dem Individuen nicht als feststellbare Entitäten existieren, sondern als Potentialitäten verstanden werden müssen, die sich entlang der dynamischen Steigerung und Schwächung ihrer Macht konstituieren. Menschliche Individuen sind vor diesem Hintergrund nicht nur determinierte Einzeldinge der Natur, sondern ihnen ist eine Potentialität eigen, die zugleich die Potentialität der Natur ist. Potentialität ist also eine Form der Macht, durch die Individuen überhaupt existieren und sich im Gesamtzusammenhang der Natur erhalten können, und ihre Individualität ist damit als eine bestimmte Dauer und als ein ständiger Übergang zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit zu verstehen.
Dementsprechend ist das allgemeine Seinsprinzip der potentia zugleich die Wirkungsmacht eines jeden Individuums. Als metaphysisches Prinzip bleibt sie unspezifisch, als reale Wirkungsmacht aber ist sie die potentia agendi eines jeden Individuums und damit dessen individuelle Handlungsmacht.21 Das allgemeine Prinzip der potentia als Macht Gottes und der Natur wird so zu einer in die menschliche Lebensform modifizierten potentia agendi, d. h., die unbedingte und unendliche Potentialität Gottes und der Natur wird zur bedingten Handlungsmacht des endlichen Individuums.22 Wir haben es hier mit einem immanenten Begriff von Macht als Potentialität zu tun und die Voraussetzung der Immanenz hat erheblichen Einfluss auf die Frage, wie Individuation sich vollzieht und wie menschliche Individuen sich bilden und erhalten.23 Von ihrer immanenten Anlage ausgehend wird deutlich, dass Macht ein Potential zur Realisierung von Möglichkeiten ist und eng mit der Handlungsfähigkeit des Individuums und dessen Fähigkeit verknüpft ist, sich im Gesamtzusammenhang der Natur zu erkennen und seine Freiheit zu realisieren. Die Macht der einzelnen Dinge hängt also für Spinoza mit der Macht der ganzen Natur zusammen. Dabei bestehen die Macht des Individuums und sein Weg zur Freiheit darin, sich durch die Erkenntnis des Gesamtzusammenhangs der Natur aus dieser Natur herzuleiten.
Im Unterschied zum weiten Begriff der potentia nutzt Spinoza den Begriff der potestas für konkrete Wirkungszusammenhänge, in denen Individuen äußeren Kräften ausgesetzt sind, in deren Gewalt sie stehen. Die Stärke des Begriffs der potestas besteht darin, die Koordinaten von Macht und Ohnmacht in praktischen Effekten und konkreten Verhältnissen sichtbar zu machen und auf diese Weise zu einem Bild von Macht zu kommen, das auch deren Asymmetrie in institutionalisierten Konstellationen offenlegen kann. Macht als potentia ist dagegen nicht auf konkrete Gewalt- und Herrschaftsverhältnisse reduzierbar, sondern eben eine grundlegende Potentialität, in der Wirklichkeit und Möglichkeit ineinander umschlagen können. Potentia und potestas sind keine entgegengesetzten Register von Macht, sondern potestas ist die je aktualisierte Verdichtung eines in der Natur vorliegenden allgemeinen Seinsprinzips der Potentialität.
Es ist also deutlich geworden, dass die metaphysische Konzeption der potentia im Hintergrund eines Begriffs von Potentialität steht, der für die Bestimmung der Macht und der Freiheit der Individuen ausschlaggebend ist. So ist der metaphysische Begriff der Potentialität auf die Wirkungsmacht des menschlichen Individuums zu übertragen, um die individuelle Macht, zu handeln und etwas zu bewirken, sichtbar zu machen und Möglichkeitsspielräume zu erkennen. Auf der Ebene des ontologischen Modells von Substanz, Attributen und Modi bedeutet das, dass die selbstursächliche Wirkungsmacht der Substanz zur kausal bedingten Handlungsmacht der Modi wird. Und von dieser grundlegenden immanenten Kausalität ausgehend, geht es für Spinoza um die Frage, wie endliche Modi sich in möglichst hohem Maße zur Ursache ihrer selbst machen und ihre Macht nutzen können. Die allgemeine Potentialität der Macht als potentia wird hier zur potentia agendi der Individuen, und erst in diesem Machtgewinn, also in der Umsetzung allgemeiner Macht in individuelle Handlungsmacht, liegt die Möglichkeit, selbstbestimmt und frei zu handeln.24 Erst aus der potentia agendi, also aus der Macht des Individuums, zu handeln und etwas zu bewirken, ergibt sich die Kontinuität, in der es zur umgebenden Welt steht, denn Handlungen sind reale Akte, die Möglichkeitsspielräume eröffnen und durch den Anschluss von weiteren Handlungen Kontinuität herstellen und sichern.25 Wie Spinoza bereits in der siebten Definition zu Beginn der Ethica feststellt, ist nur das Ding „frei, das allein aus der Notwendigkeit seiner Natur heraus existiert und allein von sich her zum Handeln bestimmt wird“ (E1d7). Freiheit ist also ein Handeln aus der eigenen Natur oder die Macht eines menschlichen Individuums, „etwas zuwege zu bringen, das durch die Gesetze seiner Natur allein eingesehen werden kann“ (E4def8).26
Potentialität der Affektionen
Spinozas komplexe theoretische Figur kausaler Selbsterzeugung und die mit ihr verbundene Freiheit des menschlichen Individuums finden in der Lehre von den Affektionen und den Affekten ihre praktische Realisierung. Der modus operandi im Übergang von einer gegebenen Wirklichkeit zu anderen Möglichkeiten ist für ihn der Umgang mit den Affektionen und ihre Erkenntnis. Das Affektionsgeschehen wird als ein grundlegender kausaler Wirkungszusammenhang verstanden, in den die menschlichen Individuen als Modi eingelassen sind. Dieser Wirkungszusammenhang der Affektionen ist immanent, und das bedeutet, dass er für das menschliche Individuum erkennbar und verstehbar ist. Die Erkenntnisfähigkeit der menschlichen Individuen ist auch eine Affektfähigkeit, durch die sie sich im Gesamtzusammenhang der Natur und ihrer immanenten Kausalität orientieren und zu Handlungsmacht und damit zu Freiheit kommen können.27Das Individuum kann sich steuernd in diesem Zusammenhang bewegen und die Affektionen meiden, die seine Macht hemmen, sowie die suchen, die seine Macht steigern. Diese Form kausaler Selbsterzeugung bedeutet allerdings nicht, dass menschliche Individuen ihre Determiniertheit ganz überwinden und vollständig autonom werden könnten. Das Affektionsgeschehen selbst zu bestimmen, und die eigene kausale Wirkungsmacht zu erweitern, heißt nicht, sich den Affektionen vollständig entziehen zu können. Im Rahmen des ontologischen Modells macht Spinoza deutlich, dass es eine vollständige Immanenz, also ein reines Aus-sich-selbst-Sein nur für Gott, die Natur und die Substanz geben kann, aber nicht für die Modi, also auch nicht für die menschlichen Individuen. Innerhalb der Substanz sind die Einzeldinge determiniert und in Affektionsverhältnisse eingelassen, d. h., eine vollständige Autonomie des Individuums kann es ontologisch nicht geben. Das wird auch daran deutlich, dass Spinoza menschliche Individuen ja gerade aus ihrer kausalen Bedingtheit herleitet und ihre Möglichkeitsspielräume nach Maßgabe der Fähigkeit auslotet, das Affektionsgeschehen zu steuern. Wie ein menschliches Individuum denkt, fühlt und handelt, ist also aus der komplexen Geschichte der kausalen Wirkungen herzuleiten, in denen es steht – und d. h. aus der komplexen Geschichte seiner Affektionen.
Potentialität ist also als eine immanente Kontinuität auszuweisen, aus der sich ein Spiel von Wirklichkeit und Möglichkeit ergibt. Individuation zeigt sich so einerseits als eine Eingrenzung in einen Raum notwendiger Wirklichkeit und andererseits als eine Entgrenzung in einen Raum relativ freier Möglichkeiten. In der dritten und vierten Definition des vierten Teils der Ethica unterscheidet Spinoza auch zufällige Einzeldinge (res singulares) von möglichen Einzeldingen und bestimmt die zufälligen (contingentes) Einzeldinge als diejenigen, bei denen wir nichts finden, „was ihre Existenz notwendigerweise setzt oder notwendigerweise ausschließt“ (E4d3). Die möglichen (possibile) Einzeldinge sind hingegen diejenigen, von deren Ursachen wir nicht wissen, „ob diese Ursachen bestimmt sind, sie hervorzubringen“ (E4d4). Im Falle zufälliger oder kontingenter Einzeldinge wissen wir also nicht, ob ihre Existenz notwendig ist oder nicht, und im Falle möglicher Einzeldinge wissen wir nicht, ob sie durch ihre Ursachen mit Notwendigkeit hervorgebracht sind oder nicht.28 Hier kann zwischen einer epistemischen und einer metaphysischen Konzeption von Möglichkeit unterschieden werden, wobei die epistemische Konzeption darauf hinausläuft, dass nur die Dinge für möglich gehalten werden, die wir in den Grenzen unseres Wissen finden. Die metaphysische Konzeption von Möglichkeit hingegen läuft darauf hinaus, dass nur solche Dinge möglich sind, die mit den Gesetzen der Natur übereinstimmen, wobei sich auch die Frage der Aktualisierung von Dingen stellt, d. h. die Frage, ob es mögliche Dinge gibt, die noch nicht aktualisiert sind, sich aber aktualisieren können. Die Bestimmung von Wirklichkeit und Möglichkeit lässt sich in Hinblick auf die Individuation menschlicher Individuen als ein Prozess der Erkenntnis notwendiger Bedingungen und der Aktualisierung von Möglichkeiten durch diese Erkenntnis verstehen. Das Affektionsgeschehen ist so gesehen ein Möglichkeitsprinzip, denn Affektionen sind in erster Linie heteronome Konstitutionsvorgänge, die sich aus dem immanenten Wirkungszusammenhang ergeben, in dem Individuen stehen, sofern sie Modi der Substanz sind. Versteht man Affektionen und Affekte hingegen als klassifizierbare und qualitativ bestimmbare Einheiten individuellen Befindens, so zeigen sie sich in einer ganz anderen Perspektive, in einer Perspektive nämlich, die das menschliche Individuum schon voraussetzt und die ontologische Frage unbeantwortet lässt, wie es in den Wirkungszusammenhängen des Ganzen zustande kommt.
Spinoza zielt also auf die Fähigkeit des menschlichen Individuums, die Affektionen zu steuern und im Sinne eines Übergangs von einer Wirklichkeit zu anderen Möglichkeiten zu lenken. Der Umgang mit den Affekten besteht nicht darin, sie durch die Herrschaft des Verstandes zu neutralisieren, sondern darin, sie in ihren kausalen Verbindungen zu erkennen, sie gegebenenfalls in andere Verbindungen zu stellen und anders zu verknüpfen, um Handlungsmacht zu generieren. Die Potentialität des Affektionsgeschehens realisiert sich also im Gesamtzusammenhang der Affektionen, in dem das Individuum zu seiner individuellen Freiheit gelangen kann. Spinoza sucht die kausale Verkettung des Individuums in der Natur nicht zu negieren, sondern in einer Weise rational zu lenken, die es dem Individuum erlaubt, sich in Glück und Freiheit zu erhalten. Affektionen sind also Bedingungen der Individuation, und in ihnen liegt eine Potentialität, die dem Individuum Möglichkeitsspielräume eröffnet.
Um auf die eingangs angeführte Frage nach Determinismus und Freiheit in Spinozas Konzeption von Potentialität zurückzukommen, soll hier noch einmal betont werden, dass Spinozas Substanz keine fundierende Wesenseinheit ist, aus der die einzelnen Dinge hergeleitet und durch die sie bestimmt werden. Der ontologische Grundbegriff der Substanz ist vielmehr als eine nominale Einheit zu verstehen, die die Kontinuität von Modifikationen und ihre immanente Individuation in dynamischen Relationen zu denken erlaubt. Durch diesen Rahmen werden die Möglichkeitsbedingungen des menschlichen Individuums in ihrer Potentialität ausgewiesen, und in diesem Sinne ist Spinozas Metaphysik auch eine Ethik.