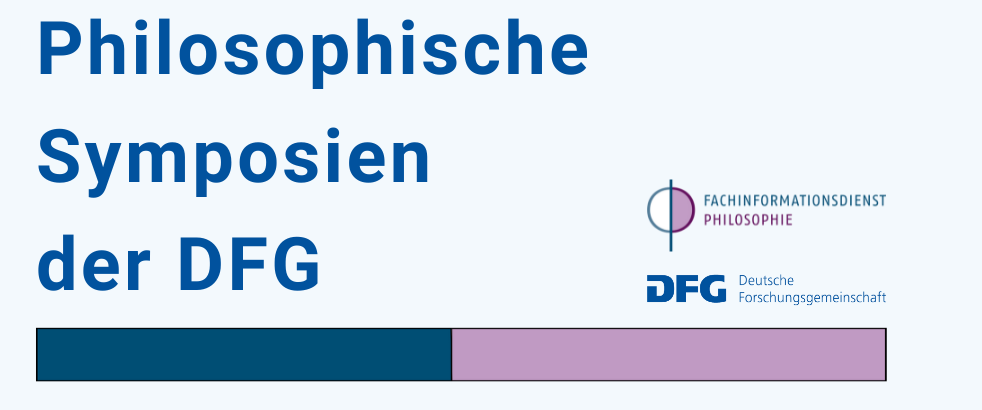Q&A – Geistige Vermögen
Q&A – Geistige Vermögen
(1) Frage: Zentral für Worthmanns Überlegungen ist die Position, dass man mit der Zuschreibung von mentalen Zuständen Fähigkeiten bzw. Vermögen zuschreibt. Aber ist das so? Wie verhält es sich etwa mit Qualia? Welche Art Vermögen ist eine Rot-Empfindung, die ja durchaus als mentaler Zustand klassifiziert werden kann? Wäre hier womöglich Lewis‘ Theorie zu Qualia hilfreich, der zufolge Qualia auf einen gewisses Wissen-wie (knowledge-how) reduziert werden können?
(1) Antwort: Ich halte den Ansatz, sogenannte Qualia auf Fähigkeiten zurückzuführen, in Bezug auf einige Phänomene, die unter diesem Etikett verhandelt werden, für vielversprechend. Allerdings hat der Ansatz seine Grenzen. Insbesondere ist diese Antwortstrategie dort naheliegend, wo die Veränderung, welche eine Person erfährt, die z.B. eine neue Farberfahrung sammelt, als ein Wissens- oder Kompetenzerwerb charakterisiert wird. Der Erwerb des Rot-Begriffs wäre demnach nichts anderes als der Erwerb einer Reihe von Fähigkeiten, wie etwa jene, rote Dinge mittels Wahrnehmung zu erkennen, sich rote Gegenstände vorzustellen oder Rotes zu erinnern. Eine Philosophin mit phänomenalistischer Neigung würde jedoch sogleich anmerken, dass bei dieser Beschreibung dazu übergegangen wurde, eine episodische Rot-Empfindung als Manifestation von bestimmten Fähigkeiten (Erkennen, Vorstellen, Erinnern) zu verstehen, und sie könnte einwenden, dass die ursprüngliche Frage lautete, ob die Rot-Empfindung selbst – also dasjenige, was qua Phänomenalismus dem Erkennen, Vorstellen und Erinnern als Gegenstand gemein ist – selbst eine Fähigkeit ist. Diese Frage lässt sich wohl nur mit „Nein“ beantworten, denn qua Beschreibung handelt es sich um einen episodischen Vorgang und nicht um ein Vermögen. Zu diskutieren wäre nun, ob diese Beschreibung überhaupt angemessen ist, sprich ob diesen Vorgängen wirklich etwas gemein ist.
(2) Frage: Worthmann unterscheidet in seinem Beitrag zwei Verwendungen von Vermögenszuschreibungen: die eine zielt auf den zugrundeliegenden Mechanismus ab; die andere auf ein „bestimmtes Können“. Ist diese Unterschiedung erschöpfend? Können wir mit Vermögenszuschreibungen nicht auch auf ein “Wie?” abzielen? Und würden wir da eher auf einen zugrundeliegenden Mechanismus Bezug nehmen oder auf ein Können (oder etwas anderes)?
(2) Antwort: Es ist sicherlich nicht ohne weiteres auszuschließen, dass neben den von mir angeführten Verwendungsweisen von Vermögenszuschreibungen weitere zu unterscheiden sind. Der Umstand, dass wir mit Vermögenszuschreibungen Wie-Fragen beantworten können, spricht jedoch meines Erachtens nicht dafür, der von mir gezogenen Zweiteilung eine dritte Unterscheidung hinzuzufügen, da wir mit solchen Fragen entweder eine Spezifikation des Vermögens oder aber eine Erläuterung des dem Vermögen zugrundeliegenden Mechanismus erbeten. Zudem würde ich die Frage, ob wir mit Wie-Fragen „eher auf einen zugrundeliegenden Mechanismus Bezug nehmen oder auf ein Können“ abzielen, insofern zurückweisen wollen, als dass beides möglich ist. So mag sich beispielsweise ein Grundschullehrer fragen, wie (auf welche Weise; mithilfe welcher Technik, Methode oder Kompetenz) eine Schülerin eine Reihe von Ergebnissen von Multiplikationsaufgaben erlangt hat. Hat sie die Ergebnisse der Aufgaben auswendig gelernt oder hat sie die Aufgaben durch Rechnen gelöst? In diesem Fall zielt die Wie-Frage darauf ab, eine Verhaltensepisode (i.e. das Hinschreiben von Zahlen) oder das Resultat dieses Verhaltens (i.e. die Zahlen auf dem Aufgabenblatt) als Ausübung bzw. Resultat der Ausübung einer (von zwei möglicherweise ausgeübten) Fähigkeiten zu identifizieren. Die Wie-Frage ist somit eine Frage danach, welche Fähigkeit ausgeübt wurde. Fragt ein technisch interessiertes Kind hingegen, wie (auf welche Art und Weise) ein Drucker ein Blatt Papier bedruckt, lässt sich dies als Frage nach einer Beschreibung des Mechanismus verstehen: Welcher Mechanismus liegt der Disposition des Geräts zugrunde?
(3) Frage: Worthmann zeigt sich optimistisch, dass die Unterscheidung zwischen den zwei Verwendungsweisen das Problem von masks, finks und mimics für die Analyse von Vermögen bzw. Dispositionen auflöst. Ist dieser Optimismus gerechtfertigt? Sind die zwei Verwendungsweisen nicht eventuell zwei unterschiedliche Perspektiven auf ein und dieselbe Sache (wie etwa im Fall von „Wasser“ vs. „H20“), für deren Analyse sich das Problem von masks, finks und mimics wieder stellt?
(3) Antwort: Hinter dieser Frage stecken zwei wichtige Anliegen: Erstens die Sorge, dass sich Probleme wie masks, finks und mimicks für verschiedene Verwendungsweisen von Vermögensbegriffen jeweils wiederholen lassen. Zweitens die Frage nach dem Zusammenhang der von mir identifizierten Verwendungsweisen. Mein Vorschlag zur Unterscheidung zweier Verwendungsweisen sollte zunächst als ein Vorschlag zur Zurückhaltung verstanden werden. Es mag sein, dass es Beispiele für Vermögen gibt, in Bezug auf welche wir sinnvollerweise sowohl nach den Kriterien für die entsprechende Könnenszuschreibung fragen können als auch nach einem zugrundeliegenden Mechanismus. Doch die Annahme, dass dies für alle Beispiele gilt, und wir deshalb darin gerechtfertigt sind, diese beiden Verwendungsweisen durchweg als zwei Perspektiven auf ein jeweils einheitliches Phänomen zu verstehen, ist eine anspruchsvolle Hypothese. Und insbesondere in Bezug auf manche Vermögen, für die wir uns in der Philosophie des Geistes interessieren, wirkt diese Annahme wenig plausibel. So mag es etwa sein, dass der Besitz einer Überzeugung p durch eine Person S damit einhergeht, dass S in einem physiologischen Zustand ist, ohne dass sich dieser Zustand als ein dem Überzeugt-sein-das-p zugrundeliegender Mechanismus o.Ä. entpuppt. Gleichwohl mag es (wie bereits angedeutet) geistige Zustände geben, die sich auf Mechanismen zurückführen lassen. Ich wollte vor allem die in der Philosophie des Geistes verbreitete Tendenz kritisieren, in Bezug auf diese Fragen eine vorschnelle, einheitliche Antwort in die eine oder andere Richtung zu geben. Vielmehr sollte die Option ernstgenommen werden, dass sich manche Vermögen auf Mechanismen zurückführen lassen und andere nicht. Akzeptiert man diese Option, eröffnet sich meinem Vorschlag zufolge ein neuer Weg, mit Problemen wie masks, finks und mimicks umzugehen, insofern alle begrifflichen Aspekte eines Vermögens zur Individuation des Vermögens herangezogen werden können aber nicht müssen. Akzeptierte man, dass verschiedene Vermögen unterschiedlich spezifiziert werden und daher keine einheitliche Analyse (etwa gemäß der EKA) möglich ist, würden zumindest viele Beispiele der genannten Probleme (trivialerweise) den Status eines Gegenbeispiels gegen eine solche Analyse verlieren.
(4) Frage: Weiterhin: Vielleicht finden sich auf der fundamentalsten Ebene der Wirklichkeit rein dispositionale Eigenschaften, denen keine kategorischen Eigenschaften und entsprechend kein Mechanismus zugrunde liegen. Hier können wir die beiden Verwendungsweisen eventuell gar nicht mehr unterscheiden und das Problem von masks, finks und mimics taucht wieder auf.
(4) Antwort: Das möglicherweise dispositionale Eigenschaften existieren, denen keine kategorischen Eigenschaften zugrunde liegen, zieht meines Erachtens meine Unterscheidung nicht in Zweifel. Vielmehr würde sich dieser Umstand in mein Bild gut einfügen: So gäbe es manche Vermögen, die auf Mechanismen zurückzuführen sind; andere, die nicht auf Mechanismen zurückzuführen sind, obgleich ihnen kategorische Eigenschaften zugrunde liegen, welche jedoch für die Individuation des Vermögens irrelevant sind; und schließlich die in der Frage genannten Dispositionen, denen keine kategorischen Eigenschaften zugrunde liegen. Meinem Verständnis nach lassen sich masks, finks, mimicks als nicht-normale Verbindungen zwischen Stimuli (bzw. Triggern; Auslösebedingungen), zugrundeliegenden kategorialen Eigenschaften und Manifestationen (bzw. Ausübungen) verstehen. Sollte mein Ansatz grundsätzlich korrekt sein, entstehen die genannten Probleme durch (begriffliche) Fehler bei der Individuation von Vermögen unter Rekurs auf manche oder alle dieser Bestandteile. Damit ginge lediglich einher, dass dispositionale Eigenschaften, denen keine kategorischen Eigenschaften zugrunde liegen und deren Manifestation nicht von Stimuli oder Auslösebedingungen abhängt, nicht von den genannten Problemen betroffen sein können.