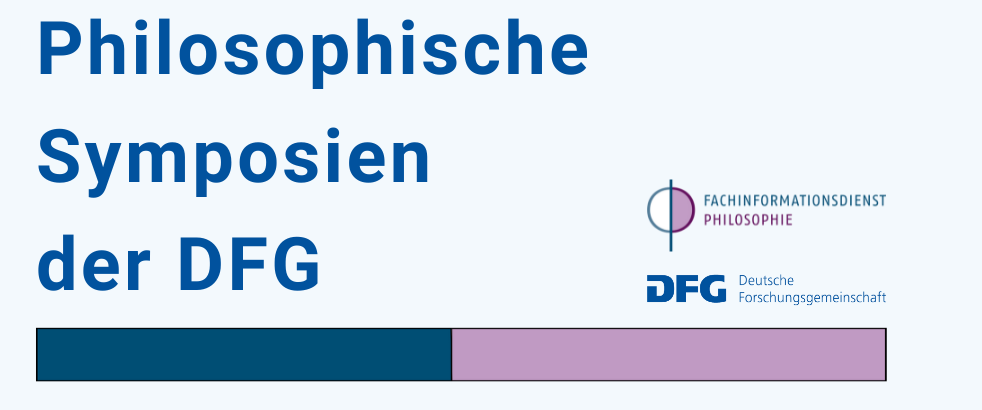Q&A – Handeln aus Gründen und Dispositionen
Q&A – Handeln aus Gründen und Dispositionen
(1) Frage: Mayr konfrontiert in seinem Beitrag die dispositionale Analyse von (absichtlichem) Handeln bzw. Handeln aus einem Grund mit einem Gegenbeispiel. Warum könnte man das Gegenbeispiel nicht dadurch vermeiden, dass man entweder eine feinkörnigere oder eine grobkörnigere Individuierung von Handlungen vornimmt? Oder etwa dadurch, dass man darauf hinweist, dass die Handlung in Mayrs Beispiel verschiedene Aspekte aufweist, die jeweils unterschiedliche Dispositionen manifestieren?
(1) Antwort: Eine grobkörnigere Individuierung von Handlungen wäre für VerteidigerInnen der kausalen Analyse an dieser Stelle wenig hilfreich, da sie es noch einfacher machen würde, Fälle zu finden, wo ein und dieselbe Handlung von einem Wunsch rationalisiert werden, der sich in der Handlung manifestiert, ohne dass die Handlung aus diesem Wunsch (und mit dem Ziel, diesen zu realisieren) ausgeführt wird. Die einzige Hoffnung müsste hier also in der Wahl eines feinkörnigeren Handlungsverständnisses liegen. Aber es scheint mir, jedenfalls soweit wir bei den Handlungsbeschreibungen bleiben, die wir normalerweise verwenden, immer noch möglich zu sein, Handlungen zu finden, für die die Rationalisierungs-und Manifestationsbedingung erfüllt ist, obwohl die Handlung nicht mit dem entsprechenden Ziel ausgeführt wurde. Das gilt sogar dann, wenn wir im Sinne ‚feinkörniger‘ Handlungsauffassungen annehmen, dass jeder dieser unterschiedlichen Beschreibungen auch eine eigene Handlung korrespondiert. (Im Text diskutiere ich das (s. 16) für den von mir skizzierten Fall der Dirigentin Anna.) Dass wir solche Handlungen immer noch finden können, reicht dafür aus, dass es Gegenbeispiele gegen die dispositional intepretierte Analyse von Handeln aus Gründen gibt. Handlungsindividuierungen, die zumindest einigermaßen an unsere gewöhnliche Redeweise über die Identität von Handlungen anknüpfen können, scheinen daher nicht ‚feinkörnig‘ genug, um dem aufgeworfenen Problem zu entgehen.
Das Ergebnis könnte ein anderes sein, wenn wir zwischen besonders ‚feinkörnigen‘ Aspekten von Handlungen in der am Ende der Frage vorgeschlagenen Weise unterscheiden und postulieren, dass sich in jedem Aspekt genau eine Disposition (und nicht mehr) manifestiert. Aber es bräuchte ein weiteres Argument für die Annahme, dass es bei jeder Handlung, die aus einem Grund ausgeführt gibt, solche Aspekte, in denen sich jeweils nur eine einzige Disposition manifestieren kann, geben muss. Mir erscheint eine solche Annahme und das damit verbundene Verständnis der Manifestation von Dispositionen jedenfalls unplausibel. Auch wenn wir den Bereich der Handlungstheorie verlassen, finden wir für eine Annahme dieser art keine Belege. Wenn sich z.B. zwei gleich geladene Teilchen abstoßen, dann ist die auftretende Veränderung eine, in dem sich die Dispositionen beider Teilchen zugleich manifestieren. Und so scheint es bei den meisten Dispositionen (ich möchte nicht so weit gehen zu sagen, bei allen) zu sein, dass sie sich immer oder normalerweise im Zusammenwirken mit anderen Dispositionen manifestieren (bzw. sogar manifestieren müssen) und wir die resultierende Veränderung gleichermaßen als der Manifestation der verschiedenen Dispositionen geschuldet ansehen.
(2) Frage: Warum sollte es nur eine korrekte Beschreibung davon geben, aus welchem Grund ein Akteur handelt? Ist die Frage, ob jemand aus einem bestimmten Grund handelt, nicht abhängig von der Beschreibungsebene, sodass unter manchen Beschreibungen der Wunsch der Dirigentin tatsächlich der Grund ist, aus dem sie handelt, während er es unter anderen Beschreibungen eben nicht ist?
(2) Antwort: Es ist sicher zutreffend, dass wir den Ausdruck ‚der Grund, aus dem jemand handelt‘ in der Alltagssprache sehr weit verwenden. Insbesondere beschränken wir diese Redeweise nicht auf Fälle, wo wir Faktoren identifizieren, die zeigen, dass aus Grund der Akteurin etwas für ihr Verhalten sprach. (Wir reden ja, zum Vergleich, auch von einer neuen Magmaeruption als ‚dem Grund, aus dem der Vulkan ausgebrochen ist‘, ohne damit zu suggerieren, dass aus Sicht des Vulkans sein Ausbruch irgendeinen Sinn hatte.)
Es ist daher m.E. durchaus zuzugestehen, dass es eine völlig legitime Verwendungsweise dieses Ausdrucks gibt, in dem der Wunsch der Dirigentin Anna als ‚der Grund, aus dem sie gehandelt hat‘, bezeichnet werden kann. Dies scheint mir jedoch nicht primär der Möglichkeit, verschiedene Beschreibungsebenen zu unterscheiden, geschuldet zu sein, sondern verschiedenen Bedeutungen von ‚Grund‘. Aber die in der Debatte um Davidsons ‚Actions, Reasons and Causes‘ und der klassischen ‚kausalen‘ Handlungstheorie einschlägige Bedeutung von ‚Grund‘ ist eine spezielle oder, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad eine technische (auch wenn sie m.E. klar an eine alltagssprachliche Bedeutung von ‚Grund‘ anknüpft). Es ist hilfreich, sie etwas vereinfachend, an die Redeweise von den ‚Zielen‘, mit denen jemand handelt, anzugleichen (vgl.a. S. 5). Wenn wir das tun, sehen wir auch besser, dass der fragliche Wunsch der Dirigentin eben nicht das Ziel, mit dem sie handelt, liefert.
(3) Frage: Wenn Mayrs Gegenbeispiel aller Kritik standhalten sollte, dann scheitert der Versuch, die kausale Theorie des Handelns aus Gründen durch eine dispositionale Analyse zu retten. Wo stehen wir aber, wenn wir uns von einer kausalen Theorie entfernen? Welche alternativen Theorien bieten sich an? Sollten wir generell von einer vermögensbasierten bzw. dispositionalen Theorie von Handeln aus Gründen Abstand nehmen?
(3) Antwort: Die letztere Schlussfolgerung erscheint mir überzogen: Nichts spricht m.E. dagegen, dass Handeln auf Gründen zumindest teilweise als Manifestation bestimmter Dispositionen erklärt werden kann. Diese Dispositionen sind jedoch deutlich komplexer als Wünsche. Und, das ist noch wichtiger, sie lassen klarerweise keine Reduzierung teleologischer Strukturen auf kausale Elemente zu. (Wie ein entsprechend nichtreduktionistisches Modell von Handeln aus Gründen aussehen könnte, dazu habe ich in Understanding Human Agency (OUP 2011), Kap. 11, einen Vorschlag gemacht.) Vielmehr sind diese Dispositionen selbst (teilweise) als Dispositionen, ein bestimmtes teleologisch strukturiertes Verhalten zu zeigen, charakterisiert. Damit lassen sie aber auch keine interessante Analyse von teleologischen Erklärungen als Kausalerklärungen mehr zu. Was wir daher – wenn ich recht habe – aufgeben sollten, ist gerade die Hoffnung auf eine solche Analyse, oder auch nur darauf, dass die Qualizifierung von teleologischen Erklärungen als ‚Kausalerklärungen‘ uns wirklich entscheidend hilft, ‚richtige‘ teleologische Erklärungen von ‚falschen‘ zu unterscheiden (also die Hoffnung, die Davidson ursprünglich zur Akzeptanz der kausalen Theorie bewegt hat).
I(4) Frage: st das Problem, das Mayr für die dispositionale Analyse von Handeln aus Gründen aufgeworfen hat, ein Spezialproblem für Theorien absichtlichen Handelns? Oder tritt das Problem auch für andere dispositionale Analysen auf, wie etwa die von Mayr genannte dispositionale Analyse von Wahrnehmung? Mit anderen Worten: Lässt sich das Problem verallgemeinern?
(4) Antwort: Das Problem beschränkt sich nicht auf den Fall von Handeln aus Gründen, sondern tritt auch darüber hinaus bei dispositionalen Analysen aus. Allerdings, soweit ich sehen kann, nicht bei allen. Wesentlich ist jedenfalls, dass diese Analoga zu den auf S. 18 genannten Charakteristika aufweisen, also (1) sog. multi-track Dispositionen sind, die nicht nur eine charakteristische Manifestation haben, sondern verschiedene, und (2) dass diese Manifestationen (jedenfalls z.T.) unabhängig voneinander auftreten können. Viele volitionale und kognitive Dispositionen, die in verschiedenen Debatten eine Rolle spielen (so z.B. ethische und kognitive Tugenden im normalen Verständnis), teilen diese Eigenschaften, und wir müssen daher von davon ausgehen, dass sich das strukturelle Problem auch finden wird, wenn wir sie zur Rettung kausaler Theorien bestimmter Phänomene heranziehen, da sich auch dann die Manifestationen in – aus Sicht der kausalen Analyse – ungünstigen Weisen ‚permutieren‘ lassen.