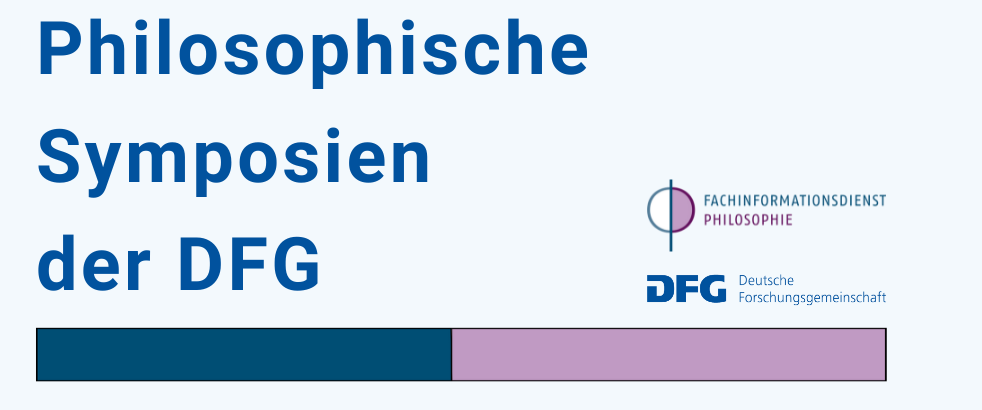Q&A – Potentialität, Kontingenz und Freiheit bei Johannes Duns Scotus
Q&A – Potentialität, Kontingenz und Freiheit bei Johannes Duns Scotus
(1) Frage: Kann Duns Scotusʼ Willenstheorie genuin rationales Wollen erklären? Er scheint ein Modell zu haben, dem zufolge der Intellekt Alternativen vorschlägt und der Wille unter diesen Alternativen auswählt. Gründe müssen hier nicht unbedingt eine wichtige Rolle spielen. Dann haben wir es doch aber mit einem sehr schwachen Sinn von rationalem Wollen zu tun.
(1) Antwort: Wie das absurde Beispiel mit der Liebe zu einer Fliege und der Liebe zu Gott verdeutlicht, ist es Scotus ein drängendes Anliegen, genuin rationales Wollen zu erklären. In der bereits erwähnten Debatte um Voluntarismus und Intellektualismus bezieht er hierbei Position gegen etwa Heinrich von Gent, der dem Intellekt beim Wollen keinerlei bestimmende Funktion beimisst, sondern ihn zu einem Diener herabstuft, dessen einzige Aufgabe darin besteht, seinem Herrn, dem Willen, mit einer Lampe den Weg auszuleuchten (vgl. hierzu Müller [2018]). So weit möchte Scotus nicht gehen, obwohl er an der Selbstdeterminiertheit des Willens festhält. Deshalb entwickelt er, wie gezeigt worden ist, das Modell eines Zusammenspiels von Wille und Vernunft bzw. Willensobjekt, das beide zu Teilursachen einer Totalursache der Handlung macht. Freilich muss, wenn der Determinismus verhindert werden will, der Wille die maßgebendere Ursache bleiben. Dies impliziert, dass der Wille nicht ohne die Vernunft entscheiden kann. Anders gesagt: Wollen ist immer begründetes Wollen, insofern das Willensobjekt und der sich darauf richtende Intellekt unverzichtbar am Zustandekommen der Handlung beteiligt sind.
Selbstverständlich kann man Scotus an dieser Stelle immer noch einen Voluntarismus vorwerfen, insofern der Wille nämlich nicht verpflichtet ist, einem bestimmten Urteil des Intellektes zu folgen; dies ließe sich auf die Spitze treiben, indem man sagt, der Wille könne also gegen die Vernunft entscheiden. Aufgrund seines Modells des unbedingten Angewiesenseins des Willens auf den Gegenstand wäre diese Variante für Scotus allerdings unsinnig. Vielmehr können die Gründe für unser Handeln unterschiedlich ausfallen, aber jedes Wollen hat stets ein Objekt, das am Zustandekommen der Handlung beteiligt ist.
(2) Frage: Selbst wenn wir den Willensakt so beschreiben, dass man sich für etwas aus bestimmten Gründen heraus entscheidet, dürfen diese Gründe doch um der Freiheit willen keine determinierenden Gründe sein. Wird dann nicht jeder Willensakt völlig willkürlich und zufällig?
(2) Antwort: Klar ist, dass die Gegenstände des Wollens nicht determinierend gedacht werden dürfen, weil sonst keine Freiheit gewährleistet ist. Man kann die Frage also zunächst umdrehen und zurückfragen: Wie soll Freiheit gedacht werden, wenn die Gründe determinierend wären?
Eine weitere Rückfrage würde lauten: Was soll denn ein willkürlicher und zufälliger Willensakt sein? Vielleicht wäre es angebrachter, hier den (nicht von Buridan stammenden) ‚Buridan’schen Esel‘, der zwischen zwei gleichen Heuhaufen verhungert, weil er sich für keinen entscheiden kann, ins Spiel zu bringen. Ich denke, dass es dieses Dilemma nicht gibt, denn unser Wille ist sehr wohl in der Lage, sich für eine Alternative zu entscheiden, auch wenn beide gleich zu sein scheinen. Der Grund dafür liegt darin, dass es eben doch zwei verschiedene Objekte sind. Was auf den ersten Blick also nach einer Willkür- oder Zufallsentscheidung aussieht, funktioniert bei näherem Hinsehen wie jeder andere Willensakt auch: Wir entscheiden uns aus einem bestimmten Grund für etwas. Wenn man aber meint, für unser Wollen einen letzten angebbaren Grund finden zu können, dann wird man – wie schon Augustinus in De libero arbitrio (II, XX. 54 bzw. III, XVII. 48f.) sagte – nicht fündig werden, denn der letzte für jeden Dezisionsakt anzunehmende Grund, warum ich will, ist, dass ich will oder – wie Scotus sagt – weil mein Wille Wille ist (quia voluntas est voluntas; Ord. I d. 8 p. 2 qu. un. [ed. Vat. IV, n. 299]).
Die Rationalität des Wollens ist für Scotus daran festzumachen, dass ich mich für einen Gegenstand um seiner selbst willen entscheide – und nicht, weil ich von Natur danach strebe oder weil es für mich angenehm ist (Scotus rekurriert dafür auf eine Unterscheidung des Anselm von Canterbury in affectio iustitiae und affectio commodi). Damit kann der Wille selbst als der unbedingt begründende Grund des Wollens angesehen werden (vgl. hierzu Mandrella [2018]).
(3) Frage: Wo liegt Scotus zufolge der erste Grund der Kontingenz? Eine naheliegende Antwort wäre: Gott. Aber diese Antwort kann auf mindestens zwei Weisen verstanden werden. Einerseits so, dass Gott durch keine Gründe gezwungen wurde, die Welt so zu schaffen, wie er sie geschaffen hat. Andererseits so, dass Gott die Welt genau so geschaffen hat, dass es Kontingenz gibt. Welches Verständnis würde Scotus vertreten? Im Anschluss daran: Wie genau bringt der menschliche Wille Kontingenz in die Welt?
(3) Antwort: Für Scotus liegt der erste Grund der Kontingenz im göttlichen Willen, insofern Gott in der Tat durch keine Gründe gezwungen war, die unsrige Welt zu schaffen, und folglich auch eine andere Welt hätte schaffen können. Dies kann man eine schöpfungstheologische Argumentation nennen, aber philosophisch gesprochen geht es um den Versuch, eine letzte abschließende Begründung dafür zu finden, dass und warum die Welt so ist, wie sie ist.
Es ist durchaus zutreffend, dass Gott also wollte und bewirkte, dass es in der Welt Kontingenz gibt. Allerdings unterscheidet Scotus einen zweifachen Begriff von Kontingenz: eine entitative, das Sein der Dinge betreffende, und eine operative, die sich auf das Wirken der Dinge bezieht. Naturvorgänge etwa sind zwar ihrem (geschaffenem) Sein nach kontingent, wirken aber notwendig, insofern sie – so hatte die Analyse es gezeigt – auf eine Wirkweise hin festgelegt sind; der Wille hingegen wirkt in seiner potentia ad opposita kontingent und bringt somit kontingente Ereignisse hervor. Entscheidend ist, dass diese Beschreibung des Willens für Scotus nicht nur für den göttlichen, sondern auch für den menschlichen Willen gilt, selbst wenn diesem qua geschaffenem entitative Kontingenz zukommt. Denn der Wille ist eine „reine Vollkommenheit“ (perfectio simpliciter), die univok von Endlichem und Unendlichem ausgesagt wird. Damit schreibt Scotus auch dem menschlichen Willen zu, Ursache von Kontingenz zu sein. Gott hat die Welt also nicht nur kontingent erschaffen, sondern mit dem willensbegabten Lebewesen Mensch auch ein Wesen geschaffen, das seinerseits Kontingentes bewirkt, d.h. von sich aus tätig wird. Unter dem Stichwort „Akteurskausalität“ wird das bis heute in der Philosophie diskutiert.