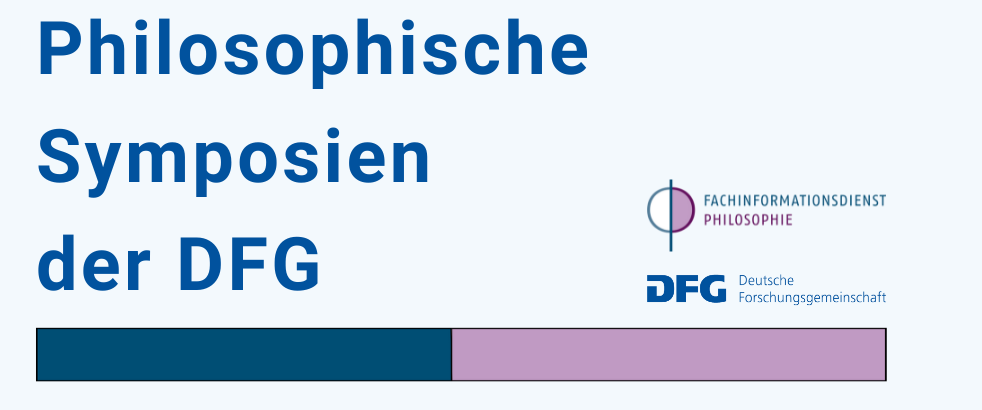Q&A - Zurechenbarkeit potentiellen und nicht-potentiellen Wissens bei Aristoteles
Q&A – Zurechenbarkeit potentiellen und nicht-potentiellen Wissens bei Aristoteles
(1) Frage: Was genau soll der Vergleich zwischen dem Peliaden- und dem Alkmaionfall erreichen? Handelt es sich nicht um grundverschiedene Fälle? Denn im Alkmaionfall wird ein schlechtes Ziel verfolgt, indem ein vorsätzlicher Muttermord begangen wird, während im Peliadenfall ein an sich gutes Ziel verfolgt wird.
(1) Antwort: Nein, in bestimmter relevanter Hinsicht geht es nicht um grundverschiedene, sondern ähnlich gelagerte Fälle. Die relevante Vergleichshinsicht besteht m.E. darin, dass in beiden Fällen eine Handlung Erwähnung findet, die in Aristoteles’ Augen schlechthin schlecht und tadelnswert ist und die daher unter keinen Umständen gewählt und vollzogen werden sollte. Instruktiv sind beide Beispiele daher insofern, als sie aufzeigen, dass Aristoteles schlechthin verbotene Handlungen angenommen hat (was man angesichts partikularistischer Deutungen der aristotelischen Ethik bezweifeln könnte), für die insbesondere gilt, dass es notwendig und/oder leicht ist, zu wissen, dass sie schlecht und verboten sind.
Im Alkmaion-Fall wird ferner nicht ein schlechtes Ziel verfolgt; die Handlung des Muttermordes stellt vielmehr das erforderliche (schlechte) Mittel dar, um das übergeordnete Gut bzw. Ziel – die Vermeidung von Hunger und Kinderlosigkeit – zu erreichen. Der springende Punkt an dem Beispiel ist m.E., dass Aristoteles daran veranschaulichen möchte, dass „nicht jedes Mittel recht ist“, um ein an sich lobenswertes Ziel zu erreichen. Muttermord ist beispielsweise eine derart schlechte Handlung, dass sie auch nicht für die Erreichung eines an sich lobenswerten Ziels (und sei dies noch so gut und lobenswert) in Frage kommt. Das Wissen darum, dass Muttermord eine derartige unter allen Umständen zu vermeidende Handlung ist, die niemals als Mittel für irgendeinen guten Zweck gewählt werden darf, ist ein Wissen, das zu besitzen nach Aristoteles notwendig und einfach ist und das daher von jedem zu besitzen und ggf. zu aktualisieren ist.
Der Vergleich mit dem Peliadenbeispiel bezieht sich darauf, dass hier in Gestalt des Kochens und Zerstückelns eine Handlung zitiert wird, die eine Handlungskonsequenz hat – i.e. den Tod der betreffenden Person, in diesem Beispiel den Tod des eigenen Vaters –, die unter allen Umständen zu vermeiden ist. Dass Kochen und Zerstückeln diese Folge haben (Aristoteles spricht hier vom Worumwillen der Handlung), ist ein Wissen, das einfach und notwendig zu besitzen ist und dessen Besitz daher von jedem erwartet werden kann.
Die Parallele zwischen dem Alkmaion- und dem Peliadenfall liegt somit in der Erwähnung einer Handlung bzw. einer Handlungsfolge, die nach Aristoteles unter keinen Umständen zu entschuldigen ist (mit anderen Worten: einer schlechthin schlechten Handlung bzw. Handlungsfolge) und für die gilt, dass das Wissen um deren Schlechtigkeit von jedem zu erwarten ist, weil es notwendig oder leicht zu haben ist.
Trotz der aufgezeigten Parallele bestehen aber freilich auch wichtige (handlungstheoretische) Unterschiede zwischen den Beispielen. Im Alkmaion-Fall fungiert eine intrinsisch schlechte Handlung, der Muttermord, als Mittel, um ein übergeordnetes Gut zu erreichen. Das Beispiel soll veranschaulichen, dass es Mittel gibt, die unter keinen Umständen zu wählen sind, gleichgültig, welches Ziel dadurch erstrebt wird. Im Peliadenfall wird dagegen in Gestalt des Kochens und Zerstückelns eine Handlung zitiert, deren Worumwillen im konkreten Fall (i.e. das Töten des eigenen Vaters) eine notwendige Handlungskonsequenz ist, die unter keinen Umständen herbeigeführt werden darf; es ist nicht zu entschuldigen, wenn jemand dieses Worumwillen der Handlung des Kochens und Zerstückelns nicht kennt und stattdessen, der fälschlichen Meinung anhängt, dass sich damit ein übergeordnetes Gut (Verjüngung des Vaters) erreichen lässt. Hier ist die Handlungsfolge, der Vatermord, intrinsisch schlecht, und es ist das Wissen um den notwendigen Zusammenhang zwischen der Handlung und deren Worumwillen, das notwendig und einfach zu haben ist.
(2) Frage: Wie genau ist bei Aristoteles Zwang von Gewalt zu unterscheiden?
(2) Antwort: Im Deutschen lässt sich in dem Sinn ein Unterschied zwischen Gewalt und Zwang treffen, als unter Gewalt eine äußere physische Gewalt (vis absoluta bzw. vis maior) zu verstehen ist, deren Einfluss nichts entgegenzusetzen ist und der sich die handelnde Person fügen muss, wohingegen unter Zwang eine Art der Einflussnahme zu verstehen ist, die physisch sein kann, aber nicht sein muss und der man sich grundsätzlich widersetzen kann, wenn auch in der Regel nur zu einem erheblichen Preis.
Dass sich auch bei Aristoteles eine entsprechende terminologische und sachliche Unterscheidung zwischen Gewalt (= bia) und Zwang (= anankê) findet, ist nicht ganz klar und es lassen sich sowohl Textstellen als auch Gründe dafür und dagegen nennen.1 Am eindeutigsten findet sich eine derartige Unterscheidung der Sache und der Begrifflichkeit nach in den pseudoaristotelischen Magna Moralia, die wegen ihrer fraglichen Authentizität die Frage nicht entscheiden können. In den beiden aristotelischen Ethiken ist die Entscheidungsgrundlage dagegen weniger eindeutig.
Ein Indiz für eine entsprechende Differenzierung lässt sich in EN 1110a32-b5 erkennen. Hier beantwortet Aristoteles die Frage danach, welche Handlungen gewaltsam (biaion) zu nennen sind, damit, dass dies solche Handlungen sind, die eine externe Ursache haben und zu denen die handelnde Person nichts beiträgt (1110b1-3). Von diesen Handlungen werden danach Fälle unterschieden, in denen eine Person nur angesichts besonderer Umstände eine Handlung wählt. Diese Fälle, die sog. „gemischten Handlungen“, sind nach Aristoteles Handlungen, bei denen die Ursache der Handlung in der handelnden Person liegt, so dass sie etwas zu ihrer Handlung beiträgt, die sie aber unter anderen Umständen nicht gewählt hätte. Beispiele für solche Handlungen hatte Aristoteles zuvor behandelt und dafür das Verb „anankazein“ (= zwingen/nötigen) verwendet.2 Insgesamt ist somit Aristoteles’ Behandlung der gemischten Handlungen mit der Annahme vereinbar, dass er mit der terminologischen Unterscheidung von bia und anankê auch eine sachliche Differenz verbindet, wonach unter bia eine externe physische Gewalt und unter anankê eine zwingende (externe oder interne) Gewalt zu verstehen ist, der man sich aber widersetzen kann.3 Für EN III lässt sich also sagen, dass in Aristoteles’ Darstellung nichts der Annahme entgegensteht, dass er hier „bia“ und „anankê“ zur Markierung des beschriebenen inhaltlichen Unterschiedes verwendet.
In der EE ist die textliche Grundlage in vergleichbarer Weise eindeutig uneindeutig wie in der EN! Zu Beginn der Behandlung von Gewalt/Zwang in EE 1224a13-18 verwendet Aristoteles zunächst viermal „bia“ und „anankê“ (bzw. deren Derivate) als Paar, ohne auf einen inhaltlichen Unterschied hinzuweisen. In 1225a17-19 folgt jedoch der folgende Satz, der am eindeutigsten für eine klare terminologische Unterscheidung zwischen „bia“ und „anankê“ sprechen würde, der aber gerade aus diesem Grund textlich umstritten ist:
„Auf diese Weise wird er also unter Zwang und [nicht] (mê) aus Gewalt handeln, oder [zumindest] nicht aufgrund der Natur, wenn er etwas Schlechtes um etwas Gutes willen oder um ein größeres Übel zu verhindern tut, und er wird unwillentlich handeln, da diese Dinge nicht bei ihm liegen.“
Die Negationspartikel „mê“ vor „Gewalt“ (bia) ist in allen Manuskripten überliefert, wurde aber von Bonitz mit der Begründung getilgt, dass in der EE „bia“ und „anankê“ stets verbunden (coniunctum) sind und nirgends geschieden würden. Es lässt sich aber auch anders erklären, weshalb bisher „bia“ und „anankê“ im Text immer als Paar vorgekommen sind und erst an dieser Stelle ein Unterschied gemacht wird:4 Es könnte sein, dass zuvor ein solcher Unterschied implizit bereits vorausgesetzt wurde, es aber bisher noch nicht darauf angekommen war, weil er sich an den bis anhin diskutierten Beispielen noch nicht festmachen ließ, das er nun aber relevant wird und daher erst hier die terminologische Differenz explizit gemacht wird.
Weder in der EE noch in der EN kommen also eindeutige Beispiele vor, die gegen die Annahme sprechen, dass Aristoteles mit der Verwendung von „bia“ und „anankê“ auch eine inhaltliche Differenzierung verbindet, nämlich zwischen äußerer physischer Gewalt, der man nicht widerstehen kann, so dass die Bewegungsursache eine äußere ist, und äußerem (oder innerem) Zwang, dem man sich widersetzen kann (wenn auch nicht muss), weswegen bei erzwungenen Handlungen die Bewegungsursache eine innere ist.
Auf der anderen Seite verlangen jedoch weder die Ausführungen in der EE noch jene in der EN die Annahme einer derartigen inhaltlichen und terminologischen Unterscheidung. Vielmehr ist auch eine alternative Deutung denkbar, worin die Differenz zwischen den Ausdrücken „bia“ und „anankê“ zu sehen ist:5 Es ist auch möglich, dass Aristoteles unter anankê jede Art von Notwendigkeit versteht, und bia eine mögliche Ursache von anankê ist, während es auch andere Arten von anankê gibt, deren Ursachen nicht biaion sind.6 Unter einer bia wäre demnach ebenfalls eine externe physische Gewalt zu verstehen, aber eine bia wäre deswegen nicht etwas anderes als eine anankê, sondern eine Art von anankê. Eine bia führt zu einer strikten Art von anankê, die keine alternativen Handlungsmöglichkeiten zulässt. Demgegenüber gibt es aber auch schwächere Arten von anankê, denen keine bia zugrunde liegt und die es zulassen, dass man ihnen widersteht und anders handelt.
(3) Frage: Was genau ist eigentlich unter potentiellem Wissen zu verstehen? Ist auch Wissen, das man nicht besitzt, über das man aber sehr einfach verfügen könnte, potentielles Wissen?
(3) Antwort: Die Antwort auf die Frage scheint mir ebenfalls nicht eindeutig auszufallen, sondern nach einer Differenzierung zu verlangen. Denn es kommt darauf an, auf welche Textgrundlage man sich bezieht. In der Textpassage, die in meinem Vortrag als Grundlage für die Redeweise von potentiellem Wissen diente, EE II 9, 1225b8-16, unterscheidet Aristoteles zwischen Wissen, das man hat (aber nicht gebraucht), und Wissen, das man nicht hat, das aber notwendig und einfach zu haben wäre und das man aus Nachlässigkeit, Lust oder Schmerz nicht hat. Da Aristoteles hier davon spricht, dass es sich bei letzterem um Wissen handelt, das man nicht hat, würde ich davon sagen, dass dies kein potentielles Wissen ist, da kein Wissen vorliegt, das eine Person aktualisieren könnte. Gleichwohl ist die Person nach Aristoteles unter den genannten Umständen (notwendiges und leichtes Wissen, das durch eigenes Verschulden nicht erworben wurde) dafür zu tadeln, dass sie dieses Wissen nicht hat. Aber aus der Textstelle in EE geht allein nicht hervor, dass er dieses nicht-vorhandene Wissen ebenfalls als potentielles Wissen bezeichnen würde.
Anders liegt der Fall m.E., wenn man die Frage unter Berücksichtigung derjenigen Textstellen beantwortet, an denen Aristoteles seine (bekannte) Unterscheidung zwischen erstem und zweitem Akt/Aktualität (energeia/entelecheia) und Vermögen (dynamis) trifft und diese an dem paradigmatischen Fall des Lernens illustriert. Er erwähnt diese Unterscheidung dreimal in seinen Werken (De An. II 1, II 5; Phys. VIII 4). Führen wir uns die Unterscheidung anhand des Beispiels des Lernens vor Augen: Ein gewöhnlicher Mensch, der noch nie etwas über Geometrie erfahren und gelernt hat, ist gleichwohl dem Vermögen nach ein Geometer; d.h. er hat (aufgrund seines Mensch-Seins) das Vermögen, geometrisches Wissen zu erlernen und dadurch der Aktualität nach ein Geometer zu werden. Nachdem er Geometrie gelernt hat, hat er das Vermögen erworben, geometrische Wahrheiten zu verstehen, d.h. sein geometrisches Wissen, das er im Zuge des Lernens erworben hat, anzuwenden bzw. zu aktualisieren. Ein Mensch, der bereits geometrisches Wissen erworben hat, dies aber gerade nicht anwendet, ist auf eine Weise nur dem Vermögen nach ein Wissender bzw. ein Geometer, denn er wendet das geometrische Wissen, das er besitzt, gerade nicht an; auf eine andere Weise ist ein solcher Mensch aber der Aktualität nach ein Geometer, weil er sein (menschliches) Vermögen, Geometer zu werden, bereits durch das Lernen des geometrischen Wissens so vervollständigt hat, dass er es nun anwenden könnte.
Hält man sich diese Unterscheidung zwischen erstem und zweitem Akt/Aktualität und Vermögen vor Augen, so erscheint es nunmehr plausibel, auch Wissen, das nur dem ersten Vermögen nach vorliegt, als potentielles Wissen zu bezeichnen. Denn ein normaler Mensch, der noch kein geometrisches Wissen besitzt, es aber erwerben könnte, verfügt laut Aristoteles dem Vermögen nach über dieses Wissen und ist deswegen auch dem Vermögen nach ein Geometer.
Da Aristoteles jedoch die Differenzierung zwischen erster und zweiter Aktualität und Vermögen im Kontext von EE II nicht explizit heranzieht, ginge es m.E. über den Wortlaut des Textes hinaus, hier auch das notwendige und einfache Wissen, von dem hier die Rede ist, als potentielles Wissen aufzufassen.
(4) Frage: Wie genau lässt sich beschreiben, dass die Subsumption unter eine allgemeine Prämisse ausbleibt? Zwei Varianten wären hier denkbar: auf der einen Seite, dass die allgemeine Prämisse einfach ausgeblendet wird; oder, auf der anderen Seite, dass man nicht erkennt, dass ein bestimmter Einzelfall unter eine allgemeine Prämisse fällt. Um welche Variante geht es Aristoteles?
(4) Antwort: Ich denke, dass sich beide Varianten Aristoteles zuschreiben lassen und dass beide Varianten auf unterschiedliche Fälle zutreffen, die Aristoteles diskutiert. Die zweite Variante charakterisiert in meinen Augen treffend, wie man sich die Situation in EE II 9 vorzustellen hat, in der eine Person aufgrund von Nachlässigkeit, Schmerz oder Lust ein notwendiges oder einfach zu habendes Wissen in einer konkreten Situation nicht aktualisiert (vgl. dazu den ersten Diskussionspunkt (i) unter dem Abschnitt „Diskussionspunkte“). Es ist hier an eine Person zu denken, die zwar allgemein über das nötige Wissen verfügt, die aber in der konkreten Situation aus Nachlässigkeit einen Einzelfall nicht darunter subsumiert. In meinem im Vortrag erwähnten Beispiel weiß der Partygast zwar, dass er nur nüchtern Auto fahren darf, er macht sich auf der Party aber nicht die Mühe, bei der Getränkewahl ganz sicher zu gehen, dass der Inhalt der Flasche, die er ergreift, auch tatsächlich ein alkoholfreies Getränk enthält.
Die erste Variante beschreibt dagegen treffend die Fälle, die Aristoteles bei seiner ausführlichen Behandlung der akrasia in EN VII 5 diskutiert. Wenn er hier den Akratiker mit einem Betrunkenen oder Schlafenden vergleicht, dessen Wissen auf vergleichbare Weise durch starke Affekte getrübt ist und infolgedessen nicht aktualisiert wird, so lässt sich das am besten derart verstehen, dass der Akratiker zum Zeitpunkt seiner akratischen Handlung aufgrund seiner emotionalen Beschaffenheit die allgemeine Prämisse ausblendet.