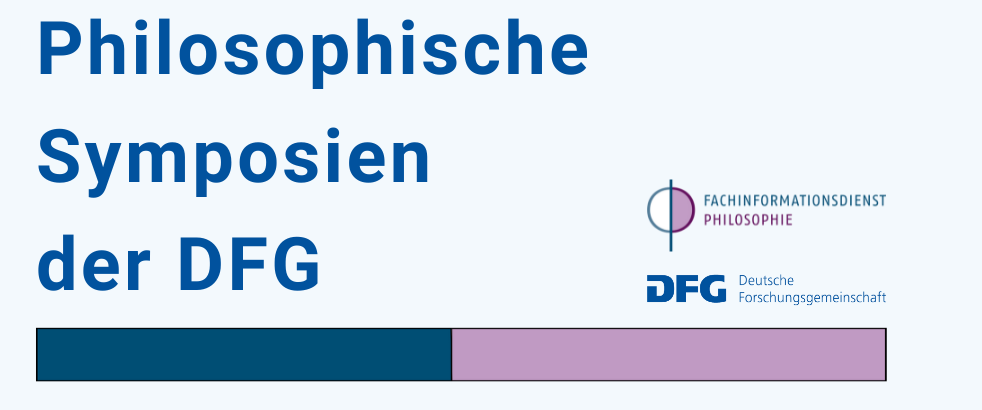Q&A – Soziale Macht als Potentialität
Q&A – Soziale Macht als Potentialität
(1) Frage: Jugov argumentiert in ihrem Beitrag für eine vermögensbasierte Theorie sozialer Macht. Aber können wir wirklich in allen Fällen sozialer Macht von Vermögen sprechen? Zum Beispiel ist es zweifelhaft, ob die soziale Macht des viktorianischen Ehemanns über seine Ehefrau zwingend darin besteht, dass der Ehemann ein bestimmtes Vermögen hat. Seine Macht impliziert zwar, dass er bestimmte Dinge tun kann. Aber dieses „können“ scheint eher ein „können“ der Zulässigkeit gemäß sozialen und rechtlichen Normen zu sein. Es scheint aber so, dass es rechtliches Können auch ohne eigentliches Können geben kann. Wir könnten uns etwa vorstellen, dass dem Ehemann immer speiübel wird, wenn er seine Macht ausüben möchte. In einem gewissen Sinne ist er dann unfähig, die Dinge zu tun, die er mithilfe seiner Macht „tun kann“. Trotzdem, so scheint es, behält er die soziale Macht über seine Ehefrau.
(1) Antwort: Dieser Einwand scheint auf einem eher aristotelischen Vermögensbegriff zu basieren. In aristotelischer Tradition muss das, was möglich ist, irgendwie auch wirklich sein (und zeitlich zumindest einmal aktualisiert worden sein). Unser Möglichkeitsbegriff heute setzt dies aber nicht mehr voraus. In der zeitgenössischen Metaphysik scheint mir ein Vermögensbegriff wie der hier vorausgesetzte – der möglicherweise nur auf einer rechtlichen Kompetenz oder einem sozialen Status basiert – schlicht als ein „generelles Vermögen“ bezeichnet zu werden (z.B. von Vetter, Jaster). Dieses kann möglicherweise „maskiert“ sein, d.h. unter bestimmten Umständen kann eine Person davon abgehalten werden, ihr Vermögen auch effektiv ausüben zu können (etwa wenn dem Ehemann aufgrund seiner moralischen Disposition immer speiübel wird, wenn er versucht seine Macht auszuüben). Doch was ich mit der Rede von modal robuster sozialer Macht in dem Beitrag meine ist genau dies: Sozial betrachtet besitzt der Ehemann robuste soziale Macht, auch wenn sein entsprechendes Vermögen punktuell (oder durch eine moralische Disposition auch über einen längeren Zeitraum und verschiedene Handlungsverläufe hinweg) maskiert wird. Dies scheint nicht zuletzt aus Sicht seiner Ehefrau der Fall zu sein: Diese kann sich nie ganz sicher sein, ob ihr Ehemann seine moralischen Dispositionen oder Vorlieben nicht vielleicht morgen doch ändert. Grundsätzlich scheint mir dieser Einwand auch die im Beitrag geforderte Unterscheidung zwischen dem Haben und der Ausübung sozialer Macht nicht ausreichend zu beachten: Ich kann ein generelles Vermögen ja auch dann besitzen, wenn ich es gerade nicht ausübe. So besitze ich beispielsweise das Vermögen eine Prüfung abzunehmen (das mir meine soziale Rolle als Professorin überträgt) auch dann, wenn ich es gerade nicht ausüben kann (etwa weil ich krank zu Hause im Bett liege). Und es sind Fälle denkbar, in denen Personen soziale Macht über andere innehaben, auch wenn sie diese niemals ausgeübt haben und dies auch nicht vorhaben.
(2) Frage: In ihrem Beitrag behandelt Jugov den Fall einer Bankräuberin, die vermittels ihrer Pistole soziale Macht über die Bankangestellten hat. Aber warum sollte es sich hier um genuin soziale Macht handeln und nicht eher um physische Macht?
(2) Frage: Viele Theoretiker haben betont, dass Macht (im Gegensatz zu purem Zwang) immer auf das freie Handlungsvermögen der machtunterworfenen Partei wirken muss: Wenn die machtunterworfene Partei gar nicht mehr frei ist, sich irgendwie zu verhalten, dann ist sie Opfer von Zwang und Gewalt aber nicht von Macht. Macht besteht darin, dass Handlungsvermögen eines Akteurs beeinflussen oder lenken zu können, dies ist aber dann nicht mehr der Fall, wenn der Akteur gleichsam als „Sache“ oder als physisches Tool gebraucht wird (natürliche könnte man nun Zwang und Gewalt als physische Macht bezeichnen, aber ich halte das für terminologisch verwirrend). Unbestritten ist die Quelle bzw. der Grund der episodischen Macht der Bankräuberin ihre Pistole, die natürlich ein extremes Zwangsmittel darstellt. Aber auch diese Form von Macht ist auf eine minimale soziale Beziehung angewiesen: Ohne dass die Bankräuberin sich in eine soziale Beziehung zu einer konkreten Person – beispielsweise dem Bankangestellten – begibt, besäße sie auch keine soziale Macht über diesen, Pistole hin oder her. Hierfür gebe ich in dem Aufsatz ein Beispiel: „Eine potentielle Bankräuberin, die sich beispielsweise die Pistole für ihren geplanten Banküberfall schon besorgt hat, aber noch damit hadert, ob das tatsächlich so eine super Idee ist eine Bank zu überfallen, besitzt in Bezug auf ihre potentiellen Opfer noch keine situationsabhängige soziale Beziehung. Dazu muss sie sich erst in eine Beziehung zu partikularen Opfern begeben, etwa indem sei eine bestimmte Bank mit dem Vorsatz des Banküberfalls betritt“ (S. 26). Meine Definition sozialer Beziehungen ist dabei wohlgemerkt sehr eng und wenig voraussetzungsvoll. Diese bezeichnet „lediglich diejenige soziale Interdependenz, die dafür notwendig ist, dass Akteur A das Handlungsvermögen von Akteur B beeinflussen kann. Akteure müssen sich nicht darüber bewusst sein, dass sie einer sozialen Beziehung zu anderen stehen“ (S.22).
(3) Frage: Jugov argumentiert, dass nur Individuen und nicht etwa Strukturen Träger sozialer Macht sein können. Nun scheint es aber denkbar, dass es kollektive Verbünde gibt, die alle Mitglieder dazu zwingen, etwas zu tun, ohne dass irgendein einzelnes Mitglied dies will. Sind solche Fälle noch mit Jugovs These über die Träger sozialer Macht kompatibel?
(3) Antwort: Ich argumentiere, dass lediglich Akteure – jedoch keine Strukturen – Träger sozialer Macht sein können. Dies schließt aber explizit die Möglichkeit ein, dass kollektive Akteure – beispielsweise Staaten oder Vereine – Träger sozialer Macht sein können. Um als Akteure gelten zu können müssen kollektive Entitäten gewisse Kriterien erfüllen. Ein wichtiges diesbezüglich Kriterium schlagen zum Beispiel Christian List und Philip Pettit in ihrem Buch „Group Agency“ vor (auf das ich mich an einigen Stellen im Aufsatz beziehe, z.B. auf S. 7 und 19): Erst wenn kollektive Akteure meta-präpositionale (und korrektive) Annahmen über ihre Annahmen erster Ordnung ausbilden können, erbringen sie List/Pettit zufolge zu personalen Akteuren äquivalente Willensleistungen. Dies können kollektive Akteure beispielsweise über institutionelle Strukturen leisten, die Entscheidungen oder Annahmen erster Ordnung nochmal einer Prüfung unterziehen. Diese Definition kollektiver Akteure schließt den beschriebenen Fall eines kollektiven Verbundes dessen kollektive Entscheidung von den Präferenzen seiner Mitglieder vollkommen unabhängig ist jedoch aus. Hier scheint es dann naheliegender, sich kein institutionell verfasstes, demokratisches Gemeinwesen (etwa einen demokratischen Staat) vorzustellen (weil der als kollektiver Akteur gelten würde), sondern eher so etwas wie einen Tyrannis oder eine Oligarchie, in der dann wieder einzelne Machthaber soziale Macht über ihre Mitglieder haben. Eine andere (und schwierigere) Frage ist, ob nicht auch Strukturen (z.B. „die kapitalistische Produktionsweise“) oder soziale Normen (z.B. sexistische Normen) soziale Macht „haben“ können. Diese Frage ist wichtig und muss viel umfassender beantwortet werden als dies hier der Fall ist. Aber mir scheint klar, dass solche Strukturen keine kollektiven Verbünde oder Akteure darstellen.
(4) Frage: Ist die Unterscheidung zwischen robuster und episodischer sozialer Macht erschöpfend oder gibt es eventuell Fälle, die in keine der beiden Kategorien passen? Wo wäre etwa die Moderatorin einer 10-minütigen Diskussion einzuordnen, die plausiblerweise über soziale Macht verfügt? Ihre Macht wäre wohl nicht episodisch, denn die Quelle ihrer Macht liegt nicht unbedingt in ihren intrinsischen Dispositionen, individuellen Ressourcen oder dem spezifischen Situationstypus. Vielmehr liegt ihre Macht in sozialen Regeln und Praktiken begründet. Die soziale Macht der Moderatorin ist aber auch nicht klarerweise robust: Wenn die Diskussion vorbei ist, gibt sie ihre Moderatorenrolle wieder ab und verliert damit die damit einhergehende soziale Macht.
(4) Antwort: Auch dieser Einwand ist sehr hilfreich. Um auf ihn antworten zu können, muss gezeigt werden, inwiefern die soziale Macht einer Moderatorin zwar von sozialen Regeln herrührt, die im Aufsatz vorgestellten Kriterien für „robuste“ soziale Macht aber verfehlt. Zwar ist es richtig, dass die Moderatorenrolle durch soziale Regeln und Praktiken festgelegt wird. Aber: Die soziale Beziehung die eine Moderatorin mit bestimmten Rollenverantwortlichkeiten und -Rechten auszeichnet ist nicht „umfassend“ und „zeitlich gestreckt“. Daher erfüllt sie die Bedingungen für eine besonders tiefgreifende soziale Beziehung nicht, die für robuste soziale Macht nötig ist. Auch hat die Moderatorin soziale Macht über diejenigen, die sie moderiert nicht in einem umfassenden Sinne, d.h. eben nicht mit Bezug auf eine Vielzahl verschiedener denkbarer Handlungsverläufe, sondern nur mit Bezug auf einen zeitlich begrenzten Teilausschnitt möglicher Handlungsverläufe in einem eng abgesteckten Setting. In diesem Sinne ist die im Aufsatz vorgeschlagene Gegenüberstellung zwischen Varianten episodischer und robuster sozialer Macht sicherlich nicht erschöpfend: Es sind andere Varianten sozialer Macht denkbar. Im Beispiel der Moderatorin etwa Macht, die durch soziale Regeln und Praktiken generiert wird, aber dennoch eher episodisch als robust ist (etwa weil sich die Regeln und Praktiken nur auf die Regelung eines bestimmten Situationstypus beziehen).