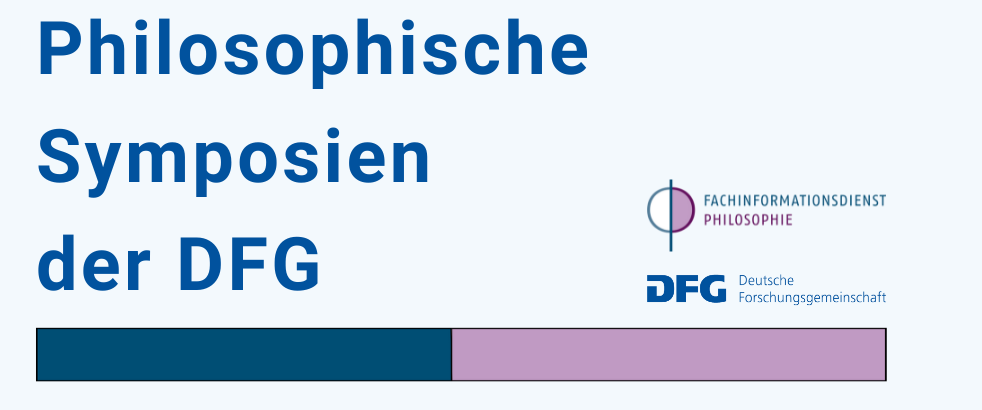Q&A - Fähigkeiten und Dispositionen
Q&A – Fähigkeiten und Dispositionen
(1) Frage: Nach Jasters Ansatz ist eine Fähigkeit, grob gesagt, eine Disposition zu zweckdienlichem Verhalten. Führt diese Theorie nicht zu einer unplausiblen Inflation von Fähigkeiten? Die Schüchternheit eines Kleinkindes kann etwa, in einem gewissen Sinne, zweckdienlich sein (weil sie etwa das Mitgehen mit fremden Erwachsenen verhindert), obwohl es sich dabei auf den ersten Blick um eine bloße Disposition und nicht um eine Fähigkeit handelt. Ist Jasters Ansatz also in seinen Fähigkeitszuschreibungen zu liberal? Könnte man das Problem eventuell lösen, indem man von „Zweckgerichtetheit“ statt von „Zweckdienlichkeit“ redet?
(1) Antwort: Von „Zweckgerichtetheit“ statt von „Zweckdienlichkeit“ zu sprechen, scheint mir eine sehr gute Idee zu sein. Ich sehe das Problem der drohenden Inflation und stimme zu, dass nicht jede Disposition auch zugleich als Fähigkeit kategorisiert werden sollte. Die Unterscheidung zwischen reiner Zweckdienlichkeit und echter Zweckgerichtetheit ist viel versprechend, um die Linie an der richtigen Stelle zu ziehen. Die Unterscheidung ist auch geeignet, eine klare Antwort auf die Frage nach der Rolle von Zuschreiberzwecken zu geben. Denn obgleich es einem Zuschreiberzweck dienlich sein kann, sein Handy dauernd fallen zu lassen, so ist dieses Verhalten ja keinesfalls auf diesen Zweck gerichtet. Zuschreiberzwecke bringen demnach keine Fähigkeiten in die Welt. Das ist ein schönes Ergebnis. Kurz: Ich bin voll und ganz einverstanden, hier die entsprechende Modifikation in der Theorie vorzunehmen.
(2) Frage: Ist es für eine Fähigkeit wirklich notwendig, dass es sich um ein Vermögen zu zweckdienlichem Verhalten handelt? Wir können uns etwa einen Mann mit großer epistemischer Autorität vorstellen, der diese Autorität allerdings nie ausspielt und ihr auch gar nicht bewusst ist. Trotzdem beeinflusst seine Autorität das Verhalten und die Reaktionen der Menschen in seiner Umgebung. Diese Beeinflussung ist allerdings nicht zweckdienlich (oder muss es zumindest nicht sein). Haben wir es hier nicht trotzdem mit einer Fähigkeit zu tun: die Fähigkeit, das Verhalten der Menschen in der Umgebung auf bestimmte Weise zu beeinflussen?
(2) Antwort: Den Vorschlag aus Punkt 1 aufnehmend, wäre die Frage, ist der Fall des Mannes mit großer epistemischer Autorität nicht Zweifel am Postulat der Zweckgerichtetheit aufkommen lassen sollte. Schließlich ist es nicht seine Intention, das Verhalten und die Meinungen anderer zu beeinflussen. Aber die Beeinflussung der anderen Menschen ist auch in keinem anderen Sinne zweckgerichtet. Dennoch übt der Mann mit seinem Verhalten offenkundig eine Fähigkeit aus.
Ich stimme zu, dass es eine Fähigkeit ist, das Verhalten und die Meinungen anderer Menschen zu beeinflussen. Zweifel habe ich daran, dass die Beeinflussung Anderer in Abwesenheit einer entsprechenden Intention nicht zweckgerichtet ist. Schließlich ist anzunehmen, dass es einen evolutionären Selektionsmechanismus gibt, der die Beeinflussung Anderer belohnt. In diesem Sinne erfüllt die Beeinflussung Anderer eine Funktion. Das ist auch so, die Beeinflussung Anderer nicht den Zwecken des Mannes selbst entspricht.
(3) Frage: Im Text behauptet Jaster, dass eine dispositionale Analyse von Nicht-Handlungsfähigkeiten nach dem Vorbild von Vetters Auffassung von Dispositionen erfolgsversprechend ist. Allerdings gibt es doch einige Nicht-Handlungsfähigkeiten, wie etwa Mustererkennungsfähigkeit, die klarerweise Stimulus-abhängig zu sein scheinen. Um etwa festzustellen, ob jemand eine bestimmte Mustererkennungsfähigkeit hat, fragen wir uns, ob die Person in einer hinreichenden Proportion möglicher Situationen, in denen ein relevanter Wahrnehmungsstimulus vorliegt, ein entsprechendes Muster erkennen würde. Wäre dann aber nicht eine Analyse nach dem Vorbild von Manley & Wassermans Auffassung von Dispositionen passender?
(3) Antwort: Vetters Analyse ist an dieser Stelle nicht im Nachteil. Wir schauen ja nur in Welten, in denen das Verhalten – in diesem Fall: die Ausbildung der Überzeugung, ein bestimmtes Muster vor sich zu haben – zweckgerichtet ist. Zweckgerichtet ist die Ausbildung der Überzeugung aber nur, wenn man das Muster vor sich hat. Das heißt, die Zweckdienlichkeitsklausel schränkt die Welten auch in Vetters Analyseschema auf die Musterwelten ein.
(4) Frage: Jaster versucht eine einheitliche Theorie von Fähigkeiten zu entwickeln, die diese als Unterart von Dispositionen versteht und folglich einen tiefgehenden Unterschied zwischen Fähigkeiten und Dispositionen leugnet. Werden mit diesem Ansatz nicht viele wichtige Unterscheidungen verwischt? So etwa Folgende: Vermögen vs. Fähigkeiten, rein physikalische Vermögen vs. zweckmäßige Vermögen, passiv vs. aktiv, allgemeine vs. spezielle Fähigkeiten usw. Was rechtfertigt die Suche nach einem einheitlichen Bild, das suggeriert, dass all diese Begriffe einen gemeinsamen Kern haben? Warum sollte man nicht geläufige Unterscheidungen zum Ausgangspunkt nehmen, um dann die verschiedenen Begriffe für sich genommen zu beleuchten?
(4) Antwort: Eine gute Fähigkeitstheorie sollte all diese wichtigen Unterschiede erklären können. Sie sollte informative Antworten auf die Frage haben: „Wann sprechen wir von dem Einen, wann von dem Anderen, und warum?“ Die systematischen Unterschiede verschiedener Arten von Fähigkeiten sollten klar ersichtlich und systematisch erläuterbar sein. Ich halte es aber für falsch, von vornherein anzunehmen, dass es keine interessanten systematischen Zusammenhänge zwischen den genannten Phänomenen gibt. Wenn es möglich ist, anhand einer einheitlichen Theorie sowohl die Zusammenhänge als auch die Unterschiede zwischen Phänomenen einzufangen, scheint mir diese Theorie klarerweise einer Vielzahl unterschiedlicher Theorien vorzuziehen, von denen jede nur ein einzelnes dieser Phänomene in den Blick nimmt. Auch analytische Philosophie sollte, soweit es eben geht, ohne Unterschiede zu nivellieren, synthetisieren.