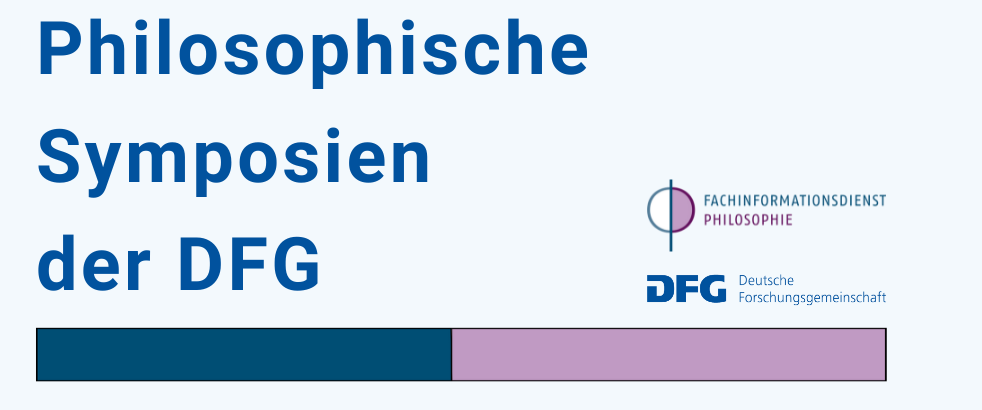Q&A – Dispositionalität und Potentialität in der Physik
Q&A – Dispositionalität und Potentialität in der Physik
(1) Frage: Hüttemann führt im Text eine Unterscheidung zwischen den internen und externen Generalisierungen, die Naturgesetzaussagen vornehmen, ein. Er veranschaulicht die Unterscheidung am Beispiel der Naturgesetzaussage „Alle Systeme einer bestimmten Art K verhalten sich gemäß der Gleichung s=1/2 gt2“. Über was genau wird bei der internen Generalisierung in der Gleichung „s=1/2 gt2“ quantifiziert und warum? Warum sollte die interne Generalisierung über „t“ und nicht über „s“ quantifizieren?
(1) Antwort: Gute Frage. Im Text hatte ich – als Beispiel – eine Allquantifikation über alle Werte von t erwähnt. Die Gleichung erlaubt aber auch eine Allquantifikation über alle Werte von s. Für die Gleichungen, die in Naturgesetzaussagen vorkommen, ist charakteristisch, dass sie unterschiedliche Quantifikationen zulassen – in diesem Fall also über t oder über s. Im Falle des idealen Gasgesetzes gibt es dann entsprechend mehr Optionen, weil es drei Variablen gibt. Der Verwendungskontext (also z. B. die Frage, was genau erklärt werden soll) legt fest, welche der internen Generalisierungen, die mit der Gleichung verträglich sind, gemeint ist.
(2) Frage: Im Text finden sich zwei, auf den ersten Blick unterschiedliche Strategien, um mit sog. Störfaktoren umzugehen. Einmal der Rückgriff auf Dispositionen generell; einmal der Rückgriff auf vielpfadige Dispositionen. Inwiefern passen beide Strategien zusammen bzw. warum werden überhaupt beide gebraucht?
(2) Antwort: Die Erklärungsstrategien sind keine Alternativen. Vielmehr zeigt sich, dass Cartwright zwar Recht hat, wenn sie argumentiert, dass die Eigenschaften, die Naturgesetzaussagen Systemen zuschreiben, am besten als Dispositionen aufzufassen sind, wenn man verstehen möchte, wie mit Störfaktoren umgegangen wird. Eine genauere Betrachtung zeigt dann aber, die These noch spezifiziert werden muss.
Wenn man das Cartwrightsche Extrapolationsargument genauer analysiert, zeigt sich, dass es uns zu der Annahme vielpfadiger (im Gegensatz zu einer Vielzahl einpfadiger Dispositionen) zwingt. Wenn man nämlich annähme, wir hätten es mit einer Vielzahl einpfadiger Dispositionen zu tun, dann würden wir, wenn z. B. ein Stein im Vakuum fällt, dem Stein eine Disposition D1 zuschreiben, wenn er dagegen in Luft fällt eine davon verschiedene Disposition D2. Es bliebe unerklärt, weshalb wir das Verhalten des Systems in der ersten Situation, in der D1 manifest wird, für explanatorisch relevant im Hinblick auf die zweite Situation, in der D2 manifest wird, halten. Das Extrapolationsargument funktioniert nur dann, wenn man annimmt, dass Naturgesetzaussagen vielpfadige Dispositionen zuschreiben.
(3) Frage: Was ist Hüttemanns zugrundeliegende Metaphysik von vielpfadigen Dispositionen? Was kann eine vielpfadige Dispositionen überhaupt anderes sein als ein Bündel von Dispositionen? Mit anderen Worten: Was genau hält die vielen Pfade einer vielpfadigen Disposition „zusammen“, sodass wir von einer und nicht mehreren Dispositionen reden dürfen?
(3) Antwort: In diesem Aufsatz ging es mir darum, die modale Oberflächenstruktur zu beschreiben, mittels derer wir (Ausschnitte der) wissenschaftlichen Praxis, z. B. der des Erklärens, am besten verstehen. Von „Oberflächenstruktur“ spreche ich genau deshalb, weil ich keine Debatte darüber führen möchte, ob die eingeführten Annahmen über Modalität und Dispositionen selbst weiter analysierbar sind (z. B. aus der Perspektive des Humeanismus). Aus der Perspektive dieses Projekts ist es also völlig in Ordnung, für die These zu argumentieren, dass die Praxis uns auf vielpfadige Dispositionen verpflichtet, ohne zu sagen, wie diese weiter zu analysieren sind. Der Fall scheint mir analog dazu zu sein, dass bestimmte Phänomene uns – im Rahmen eines Schlusses auf die beste Erklärung – auf die Existenz von Elektronen verpflichten. Das bedeutet nicht, dass wir eine Theorie dazu haben müssen, warum Elektronen genau diese Masse und jene Ladung haben. Eine solche Theorie mag es geben, hätte aber ein anderes explanandum (nicht mehr die ursprünglichen Phänomene) und wäre also eine Theorie, die einen anderen Gegenstand hat. Im Falle vielpfadiger Dispositionen mag es eine Theorie geben, die uns erklärt, was die vielen Pfade zusammenhält, vielleicht sollten wird dies aber auch (vorläufig) als primitives Faktum akzeptieren.
(4) Frage: Hüttemann charakterisiert Dispositionen als Eigenschaften, bei denen Instantiierung und Manifestation auseinanderfallen können. Erfüllt diese Charakterisierung das Ziel, dispositionale von kategorischen Eigenschaften zu unterscheiden? Kann man nicht auch etwa für „Viereckigsein“ diese Unterscheidung treffen, obwohl es sich dabei um eine paradigmatische kategorische Eigenschaft handelt?
(4) Antwort: Dispositionen habe ich als Eigenschaften charakterisiert, bei denen Instantiierung und Manifestation auseinanderfallen können. Diese Charakterisierung verfolgt das Ziel zumindest immer dann, wenn Instantiierung und Manifestation auseinanderfallen, auf das Vorliegen einer Disposition schließen zu können. Es handelt sich also um ein hinreichendes Kriterium für das Vorliegen von Dispositionen. Deshalb sollte es auf paradigmatisch kategorische Eigenschaften wie Viereckigsein nicht zutreffen. Das scheint mir auch der Fall zu sein: Ein Blatt Papier kann die Eigenschaft viereckig sein nicht instantiieren ohne es zu manifestieren. Wenn ein Blatt Papier die Eigenschaft Viereckigsein nicht manifestiert, z. B. weil es dreieckig ist, dann würden wir auch nicht sagen können, dass es die Eigenschaft Viereckigsein instantiiert. Wenn dagegen ein Krieger die Eigenschaft Tapferkeit nicht manifestiert, z. B. während er nach getaner Arbeit ein Glas Retsina trinkt, würden wir ihm gleichwohl – bei Vorliegen entsprechender Belege – zuschreiben können, dass er die Eigenschaft Tapferkeit besitzt oder instantiiert.