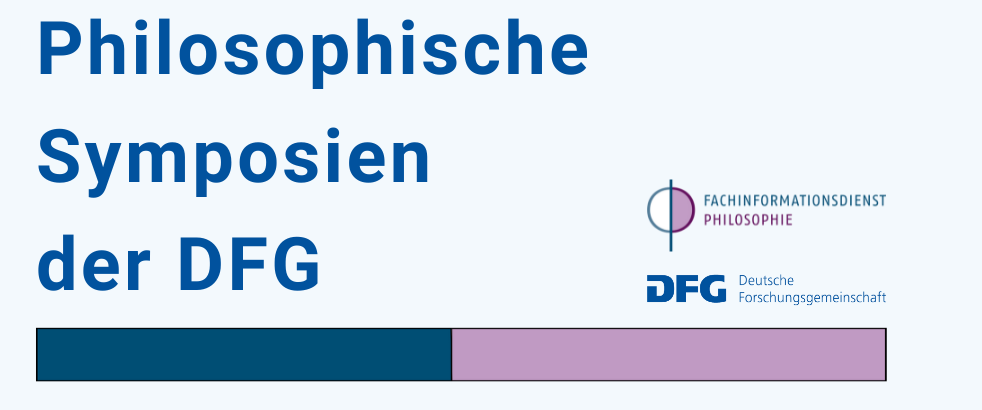Das Philosophisches Symposium der DFG zum Thema „Potentialität“
Einleitung: Das Philosophisches Symposium der DFG zum Thema „Potentialität“
Ganz gleich, ob Aristoteles Veränderung oder das gelungene Leben als Ausübung von Vermögen erklärt oder zeitgenössische Metaphysiker:innen sich über „mögliche Welten“ streiten, ob bei Kant das Sollen auch ein Können impliziert oder in der Bioethik der Status des Fötus als potenzieller Mensch diskutiert wird: In der Philosophie wimmelt es nur so vom Potentiellen, nur Möglichen, in den Dingen Angelegten, das sich manchmal, aber eben doch nicht immer, ganz verwirklicht. Zugleich ist die Rede von bloßen Potentialen auch immer wieder zutiefst suspekt erschienen, wie es in Molières berühmter Szene aus dem „Eingebildeten Kranken“ deutlich wird: Warum lässt Opium uns einschlafen? - Weil es eine virtus dormitiva hat, ein einschläferndes Vermögen! Solche Erklärungen sind zur Karikatur philosophischer Theorie geworden, von denen so manche:r Philosoph:in der Neuzeit sich gerade absetzen will und wollte. Und doch ist die Rede vom Potentiellen nie verschwunden. Das Nachdenken über Potentialität ist damit nicht nur das Nachdenken über einen zentralen philosophischen Begriff, sondern auch immer schon auch über die Erfolgs- und Misserfolgsbedingungen philosophischer Theorien.
Es ist deshalb kein Zufall, dass das erste „Philosophische Symposium“ der DFG sich dem Thema „Potentialität“ widmete. Die große thematische Vielfalt der Beiträge zeigt deutlich die Omnipräsenz des Themas, das sich historisch von Aristoteles‘ Metaphysik und Erkenntnistheorie (vgl. die Beiträge von Ursula Wolf und Béatrice Lienemann) durch das lateinische und arabische Mittelalter (vgl. die Beiträge von Isabelle Mandrella und Fedor Benevic) bis in die frühe Neuzeit (vgl. die Beiträge von Stephan Schmid und Kerstin Andermann) und den deutschen Idealismus (im Beitrag von Dina Emundts) ziehen. Deutlich werden dabei die zahlreichen Facetten des Potentialitätsbegriffs von der bloßen Existenzmöglichkeit über das aktive und passive Vermögen oder gar eine den menschlichen Geist charakterisierende „faculty“ bis hin zur immer schon ausgeübten Kraft. In der zeitgenössischen Philosophie erlebt die Rede von Potentialität eine Renaissance in der Wissenschaftstheorie (vgl. den Beitrag von Andreas Hüttemann) und Handlungstheorie (vgl. die Beiträge von Erasmus Mayr und Hannes Worthmann) sowie in der angewandten Ethik (vgl. die Beiträge von Ralf Stoecker und Katja Stoppenbrink) und sogar der politischen Philosophie (im Beitrag von Tamara Jugov). Im Vordergrund stehen dabei oft die heute natürlicheren Begriffe der „Fähigkeiten“ und „Dispositionen“ (vgl. den Beitrag von Romy Jaster); und während letztere der empiristisch geprägten Philosophie oft erkenntnistheoretisch suspekt waren, haben sie inzwischen selbst eine Rolle in der Erkenntnistheorie zu spielen (vgl. den Beitrag von Daniel Dohrn).
Mit dem Format der „Philosophischen Symposien“ möchte die DFG neue Wege in der Forschungsförderung beschreiten, die vor allem der von vielen wahrgenommenen Fragmentierung des Fachs Philosophie entgegenwirken soll. Während es zum Beispiel durch die Struktur der üblichen Fachkongresse und durch die immer mehr präferierten Publikationsformate eher selten vorkommt, dass sich systematisch und historisch arbeitende Philosoph:innen, Vertreter:innen der praktischen und theoretischen Philosophie oder selbst Expert:innen für unterschiedliche Epochen der Philosophiegeschichte gegenseitig zu ein und demselben Thema austauschen, soll das Format der „Philosophischen Symposien“ eben diesen, im universitären Alltag eher seltenen, Austausch über die verschiedenen innerphilosophischen Spezialisierungen und Fachsprachen hinweg ermöglichen. Für die Umsetzung dieser Ziele hat die vom DFG-Fachkolleg Philosophie eingesetzte Planungsgruppe wichtige Anregungen hinsichtlich des organisatorischen Rahmens gegeben: Begrenzung der Teilnehmer:innenzahl, deutlich mehr Zeit als üblich für die Diskussion der einzelnen Papers, keine Parallelvorträge, Teilnehmer:innen aus verschiedenen Fachtraditionen und in unterschiedlichen Karrierestufen, ein offener Call-for-papers, Überlegungen zur Situation des Fachs Philosophie an deutschsprachigen Universitäten usw. Diese Anregungen haben wir als eingeladene Organisatoren gerne aufgenommen und eine Art von „Pilotsymposium“ ausgetragen. Ein so weit verzweigtes Thema wie das der Potentialität kann natürlich in begrenzter Zeit und mit begrenzter Teilnehmer:innenzahl nicht einmal halbwegs erschöpfend behandelt werden; so sind die hier versammelten Symposiumsbeiträge eher als exemplarisch für die Bandbreite an verschiedenen philosophischen Perspektiven auf diesen Begriff zu verstehen. Außerdem muss sich die Ergebnissicherung bei einem primär diskussionsbezogenen Symposium anderer Formen bedienen als in der herkömmlichen Publikationsroutine. Deshalb geben die nachfolgend veröffentlichten Diskussionsprotokolle nur kostprobenweise die zwischen dem 18.03. und 22.03.2019 in der Villa Vigoni geführten Gespräche wieder.
Besonderer Dank gilt Herrn Niklas Hebing von der DFG, der das Projekt vor, während und nach dem Symposium betreut hat. Überhaupt ist dies vielleicht der richtige Ort, der DFG in Gestalt aller beteiligter Gremien für die Initiative und Unterstützung zu danken. Herrn Max Goetsch danken wir für die Anfertigung der Diskussionsprotokolle, Herrn Benjamin Keller danken wir für die Formatierung und Vereinheitlichung aller hier veröffentlichten Texte. Frau Anna Grotti danken wir für die ton- und videotechnische Begleitung des Symposiums. Besonderer Dank gilt natürlich auch den Mitarbeiter:innen der Villa Vigoni für ihre Gastfreundschaft und Flexibilität. Schließlich danken wir den Teilnehmer:innen des Symposiums für die Bereitschaft, sich mit uns zusammen auf etwas Neues einzulassen.
Barbara Vetter, Christof Rapp